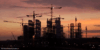Im Blick: Lohnsteuerrecht
Erster Koalitionsausschuss beschließt Maßnahmen
Drei Wochen nach Amtsantritt setzt die neue schwarz-rote Bundesregierung erste politische Akzente – und diese dürften auch für die Lohn- und Gehaltsabrechnung zeitnah spürbar werden. Der erste Koalitionsausschuss verabschiedete ein umfassendes Sofortprogramm, mit dem die deutsche Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs gebracht werden soll. Im Fokus: Steuererleichterungen, Bürokratieabbau, Investitionsanreize und arbeitsmarktpolitische Flexibilisierungen. Viele Maßnahmen sind im Koalitionsvertrag verankert – erste gesetzgeberische Umsetzungen sollen noch vor der Sommerpause erfolgen, angesichts der letzten Sitzung des Bundesrates am 11.07.2025 ein ambitionierter Zeitplan.
Steuerliche Impulse zur Belebung der Wirtschaft
Ein zentrales Element des Programms ist die Investitionsoffensive. Mit der Errichtung eines Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaneutralität sollen gezielt öffentliche und private Investitionen angeschoben werden. Erleichtert wird dies durch höhere strukturelle Verschuldungsmöglichkeiten der Länder und eine geplante Reform der Schuldenbremse, für die eine Expertenkommission eingesetzt wird.
Für Arbeitgeber und Unternehmen besonders relevant: Die Einführung eines Investitionsboosters in Form einer degressiven Absetzung für Abnutzung (AfA) für Ausrüstungsinvestitionen sowie die geplante Senkung der Unternehmenssteuerbelastung (Körperschaftsteuer und § 34a Einkommensteuergesetz (EStG)). Diese Maßnahmen sollen nicht nur Investitionen anreizen, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland stärken.
Hightech-Förderung und Standortgesetz
Unter dem Dach einer neuen Hightech-Agenda plant die Koalition gezielte Förderungen von Innovationsbranchen. Ergänzend sieht das sogenannte Standortfördergesetz eine Verbesserung der Finanzierungsmöglichkeiten insbesondere für kleinere Unternehmen und Start-ups vor – u. a. durch neue Infrastrukturfonds.
Bürokratieabbau und arbeitsrechtliche Anpassungen
Weniger Bürokratie – das betrifft auch die Entgeltabrechnung. Mit dem angekündigten Wegfall des nationalen Lieferkettengesetzes zugunsten einer europäisch abgestimmten Lösung wird ein stark regulierter Bereich dereguliert. Gleichzeitig startet ein Sozialpartnerdialog zur Flexibilisierung von Arbeitszeiten, der in der Personalpraxis große Bedeutung erlangen kann.
Konkret kündigt die Koalition an, die Regelung zur kurzfristigen Beschäftigung von Saisonarbeitskräften auf 90 Tage anzupassen. Hier ist aus Sicht der Lohnpraxis eine sorgfältige Beobachtung des Gesetzgebungsverfahrens erforderlich, da dies Auswirkungen auf Meldeverfahren, Sozialversicherungspflichten und Dokumentationsanforderungen haben kann.
Auch die Absenkung des Umsatzsteuersatzes in der Gastronomie ab dem 01.01.2026, die steuerliche Förderung der Elektromobilität sowie die Erhöhung der Entfernungspauschale zum gleichen Zeitpunkt haben mittelbare Auswirkungen auf die Lohnabrechnung – insbesondere im Hinblick auf Sachzuwendungen, Reisekostenregelungen und geldwerte Vorteile.
Arbeitsmarkt und Sozialpolitik
Die Koalition setzt neben wirtschaftlichen Impulsen auch gesellschaftspolitische Akzente. Mit einer Stärkung der Tariftreue durch ein neues Bundestariftreuegesetz will man die Tarifbindung erhöhen. Eine eigene Kommission soll Wege finden, gleichen Lohn für gleiche Arbeit zwischen Männern und Frauen zu erreichen – bei möglichst geringer Bürokratielast. Für die Personalabteilungen könnte dies neue Anforderungen in der Entgelttransparenz bedeuten.
Auch das Sozialrecht wird umfassend adressiert: Mit einem zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetz, der Einführungeiner Aktivrente sowie einer Frühstart-Rente kündigt sich eine Rentenreform mit weitreichenden Folgen an. Die Haltelinie beim Rentenniveau soll bis 2031 gesichert, die Mütterrente vollendet werden.
Fazit
Für die Lohn- und Gehaltsabrechnung könnten sich in den kommenden Monaten erhebliche Änderungen ergeben – von Steuer- und Sozialversicherungsregelungen bis hin zu arbeitszeitrechtlichen und gleichstellungsbezogenen Anforderungen. Unternehmen und ihre Entgeltverantwortlichen sollten die Gesetzgebungsverfahren aufmerksam begleiten und frühzeitig ihre Systeme und Prozesse vorbereiten.
Was ist eigentlich der Koalitionsausschuss?
Alle vorgenannten Maßnahmen sind Ergebnis intensiver Verhandlungen im Koalitionsausschuss, einem informellen Gremium zur Konfliktlösung und Grundsatzabstimmung innerhalb der Regierung. Unter dem Modell „drei + drei + drei + zwei“ sind maßgebliche Spitzenvertreter von CDU, CSU und SPD vertreten – darunter Bundeskanzler Friedrich Merz, CSU-Chef Markus Söder und der SPD-Co-Vorsitzende Lars Klingbeil. Unterstützt wurde das Gremium von zwei sogenannten Notetakern, darunter Kanzleramtschef Thorsten Frei und Finanzstaatssekretär Björn Böhning.
Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts
Mit dem „Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland“ setzt der Gesetzgeber ein deutliches Signal für Wachstum, Innovation und Modernisierung. Die Maßnahmen zielen darauf ab, insbesondere private Investitionen zu stärken und Unternehmen steuerlich zu entlasten.
Auch für die Lohn- und Gehaltsabrechnung ergeben sich konkrete Auswirkungen – vor allem im Bereich der Dienstwagenbesteuerung und bei der Förderung emissionsfreier Mobilität.
Anhebung der Bruttolistenpreisgrenze auf 100.000 Euro
Besondere Aufmerksamkeit verdient die Anhebung der Bruttolistenpreisgrenze für begünstigte Elektrofahrzeuge von bisher 70.000 Euro auf 100.000 Euro. Diese Regelung betrifft sowohl die pauschale Nutzungswertmethode (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Nr. 3 EStG) als auch die Fahrtenbuchmethode (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 3 Nr. 3 EStG). Für Fahrzeuge mit einem Bruttolistenpreis bis zur neuen Grenze ist weiterhin nur ein Viertel der Bemessungsgrundlage für die Ermittlung des geldwerten Vorteils heranzuziehen – vorausgesetzt, das Fahrzeug ist rein elektrisch oder ein Brennstoffzellenfahrzeug.
Für die Entgeltabrechnung bedeutet das: Der geldwerte Vorteil aus der privaten Nutzung eines Elektrofahrzeugs kann steuerlich deutlich günstiger bewertet werden.
Diese Maßnahme greift eine Planung aus dem früheren Steuerfortentwicklungsgesetz auf und ist nicht nur aus investitionspolitischer Sicht relevant, sondern hat auch praktische Auswirkungen auf die Lohnabrechnung.
Zugleich bleibt für den Arbeitgeber wichtig zu beachten: Die neue Preisgrenze gilt nicht rückwirkend, sondern nur für Fahrzeuge, die nach Inkrafttreten der Neuregelung erstmals angeschafft oder geleast werden.
Degressive AfA als Investitionsbooster
Ein zentrales Element des Gesetzes ist die Wiedereinführung und Ausweitung der degressiven Abschreibung (§ 7 Abs. 2 EStG) für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. Diese Regelung soll für neue Wirtschaftsgüter gelten, die nach Inkrafttreten des Gesetzes angeschafft oder hergestellt werden. Mit dem erhöhten Abschreibungsvolumen im ersten Nutzungsjahr werden Unternehmen gezielt zur Investition motiviert – eine Maßnahme, die in wirtschaftlich unsicheren Zeiten rasch Liquidität bindet und Anreize für Zukunftsinvestitionen schafft.
Schrittweise Entlastung bei Körperschaftsteuer und Thesaurierung
Weitere fiskalische Entlastung bringt die gestaffelte Absenkung des Körperschaftsteuersatzes (§ 23 Abs. 1 Körperschaftsteuergesetz (KStG)). Ab dem 01.01.2028 sinkt der aktuelle Satz von 15 Prozent schrittweise auf 10 Prozent im Jahr 2032. Parallel dazu wird auch der Thesaurierungssteuersatz nach § 34a EStG für einbehaltene Gewinne gesenkt: von derzeit 28,25 Prozent auf 27 Prozent (Veranlagungszeitraum 2028/2029), 26 Prozent (Veranlagungszeitraum 2030/2031) und schließlich auf 25 Prozent ab dem Veranlagungszeitraum 2032. Damit soll insbesondere die Eigenkapitalbildung in Unternehmen gefördert werden.
Neue Abschreibungsregel für Elektrofahrzeuge
Die Einführung einer arithmetisch-degressiven Abschreibung für neu angeschaffte Elektrofahrzeuge (§ 7 Abs. 2a EStG – neu) soll den Verkauf von Elektrofahrzeugen voranbringen. Mit der Regelung soll für neu angeschaffte, rein elektrisch betriebene Fahrzeuge die Einführung einer arithmetisch-degressiven Abschreibung mit fallenden Staffelsätzen in Höhe von 75 Prozent im Jahr der Anschaffung, 10 Prozent im ersten darauf folgenden Jahr, 5 Prozent im zweiten darauf folgenden Jahr, 5 Prozent im dritten darauf folgenden Jahr, 3 Prozent im vierten darauf folgenden Jahr und 2 Prozent im fünften darauf folgenden Jahr eingeführt werden.
Ausweitung der steuerlichen Forschungsförderung
Ergänzt wird das Investitionspaket durch eine Ausweitung des Forschungszulagengesetzes (§ 3 FZulG). Unternehmen können künftig in größerem Umfang Zuschüsse für eigenbetriebliche Forschung und Entwicklung beantragen. Gerade innovative Mittelständler sollen so in die Lage versetzt werden, verstärkt in neue Produkte, Prozesse und Technologien zu investieren – ein wirtschaftspolitisch bedeutender Hebel, um den Standort Deutschland international konkurrenzfähig zu halten.
Hinweis
Mit dem Investitionssofortprogramm bringt die neue Bundesregierung eines ihrer ersten Gesetzesvorhaben ein. Ob Bundestag und Bundesrat diesem noch vor der Sommerpause zustimmen, bleibt abzuwarten.
Wissenschaftlicher Beirat plädiert für vereinfachte Besteuerung von Arbeitnehmern
Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium der Finanzen hat ein Gutachten mit dem Titel „Vereinfachte Einkommensbesteuerung – Möglichkeiten und Grenzen illustriert am Beispiel steuerlicher Abzüge in der Arbeitnehmerbesteuerung“ veröffentlicht. Darin stellt das Gremium verschiedene Ansätze zur Vereinfachung des steuerlichen Verfahrens bei Arbeitnehmern vor. Das Gutachten ist öffentlich zugänglich und kann beim Bundesministerium der Finanzen abgerufen werden.
Zentrale Überlegung des Beirats ist es, durch Pauschalierungen und Typisierungen sowie durch die Streichung bestimmter Abzugsmöglichkeiten eine Entlastung der Verwaltung und der Steuerpflichtigen zu erreichen.
Als unabhängiges, ehrenamtlich tätiges Beratungsgremium versteht der Wissenschaftliche Beirat seine Empfehlungen als Beitrag zur öffentlichen Diskussion. Sie spiegeln nicht zwangsläufig die Position des Bundesfinanzministeriums wider.
Empfehlungen des Beirats im Überblick
Im Kern empfiehlt der Beirat folgende Reformansätze im Bereich der Werbungskostenabzüge bei Arbeitnehmern:
- Arbeitsmittel und Verpflegungsmehraufwand: Aufwendungen, die auf das direkte Arbeitsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zurückzuführen sind, sollen künftig ausschließlich beim Arbeitgeber berücksichtigt werden können. Dies betrifft insbesondere Arbeitsmittel sowie Mehraufwand für Verpflegung bei Dienstreisen. Die Folge: Der Aufwand für die Prüfung und Einhaltung der steuerlichen Vorgaben verringert sich, gleichzeitig sinkt das Risiko strategisch motivierter Falschangaben. Zudem würden sich sogenannte Quasi-Pauschalen zur Vereinfachung des Arbeitsmittelabzugs erübrigen.
- Arbeitstagepauschale statt Einzelregelungen: Die bislang getrennt behandelten Regelungen zu Entfernungspauschale, Homeoffice-Pauschale und häuslichem Arbeitszimmer sollen zu einer einheitlichen Arbeitstagepauschale zusammengeführt werden. Diese Pauschale würde bürokratische Schnittstellenprobleme vermeiden und die aufwendige Einzelfallprüfung – etwa zur Nutzung des häuslichen Arbeitszimmers – überflüssig machen. Auch die oft schwer überprüfbare Dokumentation von Büro- und Homeoffice-Tagen würde entfallen.
- Öffnungsklausel für Fernpendler: Um unzumutbare Mehrbelastungen für Fernpendler durch die Pauschalierung zu verhindern, soll eine ergänzende Regelung geschaffen werden. Diese würde weiterhin einen Abzug von Fahrtkosten oberhalb einer definierten Wesentlichkeitsschwelle ermöglichen.
- Weitere kleinere Abzüge: Steuerliche Abzugstatbestände mit regelmäßig niedrigen Beträgen, die jedoch mit erheblichem Verwaltungsaufwand verbunden sind, sollen durch die Arbeitstagepauschale abgegolten werden. Der derzeitige Arbeitnehmerpauschbetrag entfällt im Gegenzug.
- Erhalt der Abzugsfähigkeit für Fortbildungskosten: Die vollständige steuerliche Berücksichtigung von Fort- und Weiterbildungskosten soll erhalten bleiben. Zudem spricht sich der Beirat dafür aus, auch die Kosten für eine Erstausbildung als vortragsfähige Werbungskosten anzuerkennen. Bei der Prüfung weiterer Abzugsmöglichkeiten empfiehlt das Gremium, sich an den im Gutachten dargestellten Überlegungen zu orientieren.
Sollte die Arbeitstagepauschale künftig direkt in den automatischen Lohnsteuerabzug eingebunden werden, wäre eine Steuerveranlagung nur noch für solche Arbeitnehmer erforderlich, die überdurchschnittlich hohe Werbungskosten geltend machen. Ergänzend schlägt der Beirat vor, durch eine Ausweitung der Informationspflichten – etwa durch Übermittlung von Weiterbildungsdaten größerer Bildungseinrichtungen – den betroffenen Personenkreis weiter zu reduzieren.
Diese Maßnahmen könnten perspektivisch den Weg hin zu einer automatisierten Veranlagung im Bereich der Arbeitnehmerbesteuerung ebnen – ein Verfahren, das in mehreren anderen Ländern bereits gängige Praxis ist.
Praxishinweis
Ob und in welchem Umfang die Vorschläge des Beirats gesetzlich umgesetzt werden, ist derzeit noch offen. Ein Gesetzentwurf, der erste Punkte aus dem Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD aufgreifen soll, ist jedoch für die kommenden Wochen angekündigt.
Markus Stier