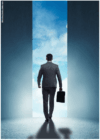Mobile Workforce Management : Flexible Arbeitszeiten sichern
In einer Arbeitswelt, die sich unter der Perspektive von „New Work“ dynamisch weiterentwickelt, stoßen Sabbaticals – also längere Auszeiten von der Arbeit – auf zunehmendes Interesse bei Mitarbeitern.
Das Angebot von Sabbaticals kann vor diesem Hintergrund eine wertvolle personalpolitische Maßnahme sein, um qualifizierte Fach- und Führungskräfte zu gewinnen, zu motivieren und langfristig an das Unternehmen zu binden. Es gilt, die sozialversicherungsrechtlichen Vorgaben zu beachten, um den Verlust des Schutzes für Arbeitnehmer und Haftungsrisiken des Arbeitgebers zu vermeiden.
Gestaltungswege fürs Sabbatical
Beabsichtigen Arbeitgeber, ihren Mitarbeitern eine Auszeit zu gewähren, ist es notwendig, diese Freistellung im Vorfeld anhand der gesetzlichen Bestimmungen zu prüfen. Dies ist wichtig, weil diverse Optionen zur Gestaltung von Sabbaticals existieren, die jeweils für den Fortbestand der gesetzlichen Sozialversicherung und damit für den Schutz der Mitarbeiter unterschiedliche Auswirkungen haben.
Es kommt darauf an, wie Mitarbeiter versichert sind und wie lange sie etwa unbezahlten Urlaub nehmen möchten. Das Sabbatical, auch Sabbatjahr genannt, steht für eine berufliche Auszeit, die zwischen einigen Wochen bis zu mehreren Monaten betragen kann. In den Betrieben werden bezahlte und unbezahlte Varianten angewendet.
Variante: unbezahlte Freistellung
Anders als Beamte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst besteht in der Privatwirtschaft kein gesetzlicher Anspruch auf ein Sabbatjahr. Ein solcher Anspruch kann kollektivrechtlich in einer Betriebsvereinbarung oder einem Tarifvertrag und einzelvertraglich zwischen den Arbeitsvertragsparteien begründet werden. In diesen Fällen vereinbaren Arbeitgeber und Arbeitnehmer für den gewünschten Zeitraum eine Suspendierung der Arbeitspflicht (Ruhensvereinbarung).
Unbezahlte Freistellung und Versicherungsschutz
Sofern ein Sabbatical durch unbezahlten Urlaub erfolgt, müssen gesetzlich krankenversicherte Arbeitnehmer darauf achten, dass sie nur für einen Monat (Zeitmonat) nach dem letzten regulären Arbeitsmonat über den Arbeitgeber sozialversichert sind. Wenn also eine Mitarbeiterin unbezahlten Urlaub ab dem 15.06. nimmt, dann endet der erste Monat am 14.07. Ab dem 15.07. muss eine anderweitige Absicherung erfolgen. Daher sollte bei der Wahl dieses Modells unbedingt vorab die sozialversicherungsrechtliche Seite mit der zuständigen gesetzlichen Krankenkasse geklärt werden.
Variante: bezahltes Sabbatical mit Wertguthaben
Ein beliebtes Modell ist die Durchführung des Sabbaticals dank eines im Unternehmen bestehenden insolvenzgesicherten Wertguthabens nach § 7b Sozialgesetzbuch (SGB) IV (steuerlicher Begriff: Zeitwertkonto). Die Beschäftigten können einen Teil ihres Bruttogehalts, Boni, Tantiemen sowie Überstunden und zusätzliche Urlaubstage langfristig ansparen und hierdurch eine längere Freistellungsphase finanzieren. Der Vorteil ist, dass die Sozialversicherungsbeiträge erst fällig werden, wenn die bezahlte Auszeit in Anspruch genommen wird, sodass der Beschäftigte dann während seines Sabbaticals auch sozialversichert bleibt. Das sollte jedoch sorgfältig vorbereitet werden, denn der Verbrauch des Wertguthabens hat nach besonderen gesetzlichen Vorgaben zu erfolgen, um ungewünschte Gestaltungen zu vermeiden. Es gilt daher der Grundsatz, dass ohne angemessenen Abbau des Wertguthabens (sogenanntes Entsparen) während einer Freistellung keine bezahlte Freistellung mit Versicherungsschutz möglich ist.
Das Arbeitsentgelt in der Freistellungsphase gilt als angemessen, wenn es im Monat mindestens 70 Prozent und maximal 130 Prozent des durchschnittlich gezahlten Arbeitsentgelts der unmittelbar vorangegangenen zwölf Kalendermonate der Arbeitsphase beträgt. Wer sich als Arbeitgeber also dazu entschließt, seinen Mitarbeitern die Möglichkeit eines Sabbaticals anzubieten, sollte diese Vorgaben beachten und im Zweifel eine rechtliche Beratung hinsichtlich der Ausgestaltung und der damit einhergehenden Risiken auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite einholen. Auch bezüglich des Wiedereinstiegs in den Betrieb nach der Auszeit müssen einige Vorkehrungen getroffen werden, die vorab geplant und vereinbart werden sollten.
Variante: bezahltes Sabbatical ohne Wertguthaben
Wichtig ist die sozialrechtliche Abgrenzung von sogenannten sonstigen flexiblen Arbeitszeiten, also außerhalb von Wertguthabenvereinbarungen wie zuvor beschrieben. Hierunter fällt etwa die bezahlte Freistellung durch das sogenannte Abfeiern von Überstunden. Die entstandenen und auf einem kurzfristigen Arbeitszeitkonto gesammelten Überstunden werden nun ausbezahlt, und der Mitarbeiter erbringt in dieser Zeit keine Arbeitsleistung. Das hat versicherungs- und beitragsrechtliche Auswirkungen, denn der sozialversicherungsrechtliche Schutz für Arbeitnehmer im Rahmen von Freistellungen aufgrund sonstiger flexibler Arbeitszeitregelungen endet nach drei Monaten.
Variante: Brückenteilzeit
Während ein gesetzlicher Anspruch auf ein Sabbatical nicht besteht, wird ein solcher Anspruch aus der Regelung zur „Brückenteilzeit“ in § 9a Abs. 3 in Verbindung mit § 8 Abs. 4 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) abgeleitet. Demnach kann der Mitarbeiter unter bestimmten Voraussetzungen eine vorübergehende Verringerung der Arbeitszeit verlangen. Sowohl der Reduzierung als auch dem Verteilungswunsch muss entsprochen werden, soweit dem keine betrieblichen Belange entgegenstehen. Voraussetzung für den Anspruch ist zudem, dass der Zeitraum der Arbeitszeitverringerung mindestens ein Jahr betragen muss und dass der Arbeitgeber in der Regel mehr als 45 Arbeitnehmer beschäftigt. In diesem Zuge können Mitarbeiter auch Wünsche zur Verteilung der Arbeitszeit während der Brückenteilzeit äußern und insbesondere eine Kombination aus Arbeits- und Freistellungsphase verlangen.
Variante: verblockte Teilzeit
Ein Sabbatical, also eine verblockte Teilzeit, führt nicht zu einer vergütungspflichtigen Mehrarbeit in der Ansparphase. Vielmehr vereinbaren die Arbeitsvertragsparteien, dass der Arbeitnehmer während der gesamten Laufzeit des Sabbaticals im Durchschnitt in Teilzeit arbeitet. Während der aktiven Phase wird dann durch die Erhöhung der Arbeitszeit ein Wertbzw. Zeitguthaben aufgebaut. Dieses Guthaben wird dann in der passiven Phase bei völliger Freistellung verbraucht und dient der Weiterzahlung der (Teilzeit-)Vergütung.
Gesetzlicher Anspruch auf Erholungsurlaub
Für die Zeit der völligen Freistellung über die Dauer eines Kalendermonats besteht kein gesetzlicher Anspruch auf Erholungsurlaub. Da der gesetzliche Urlaubsanspruch jahresbezogen zu ermitteln ist, wäre bei einer geringeren völligen Freistellung als zwölf Monate der Urlaubsanspruch für das betreffende Jahr für jeden vollen Kalendermonat nach der Formel Anzahl der Urlaubstage x Anzahl der Tage mit Arbeitspflicht zu errechnen (312 Werktage bzw. 260 Arbeitstage bei einer Fünf-Tage-Woche).
Kranken- und Pflegeversicherung
Wie beschrieben besteht bei Freistellungen weiterhin der gesetzliche Versicherungsschutz. Dies gilt allerdings nur bis zu einem Monat für die Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen- und Rentenversicherung, ohne dass in dieser Zeit Beiträge gezahlt werden müssen. Einen Monat nach Unterbrechung des aktiven Arbeitsverhältnisses muss der Arbeitgeber eine Unterbrechungsmeldung vornehmen. Damit erlischt bei Pflichtversicherten die Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung. Der Arbeitnehmer muss sich also selbst um Krankenversicherungsschutz bemühen. Ist eine langfristige und über einen Monat hinaus bestehende unbezahlte Freistellung geplant, müssen Versicherte die Beiträge zur Sozialversicherung selbst tragen. Das erfolgt in Form einer freiwilligen Krankenversicherung, beispielsweise zum Mindestbeitrag, wenn keine weiteren Einnahmen während dieser Zeit vorhanden sind, oder unter bestimmten Voraussetzungen im Rahmen der beitragsfreien Familienversicherung. Für Reisen etwa im Rahmen von Workation innerhalb Europas sowie in Abkommensstaaten ist grundsätzlich eine Absicherung für den Krankheitsfall durch eine private Zusatzkrankenversicherung zu empfehlen. So ist beispielsweise ein notwendiger Rücktransport bei einem medizinischen Notfall abgesichert. Bei Reisen außerhalb von Europa ist eine solche Zusatzkrankenversicherung zwingend notwendig. Nehmen Versicherte nach der Rückkehr aus dem Sabbatjahr die Beschäftigung wieder auf, greift ab diesem Zeitpunkt unverzüglich der gesetzliche Krankenversicherungsschutz. Wird keine Beschäftigung aufgenommen, ist auch dann die Weiterversicherung im Rahmen der freiwilligen Krankenversicherung oder der beitragsfreien Familienversicherung möglich.
Renten- und Arbeitslosenversicherung
Die Mitgliedschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung kann während des Sabbaticals ausgesetzt werden, was jedoch zu Beitragslücken für den späteren Rentenanspruch führen kann. Daher wird empfohlen, zumindest den monatlichen Mindestbeitrag in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen.
Weiterversicherung während der Freistellung
Für die Weiterversicherung gibt es jeweils zwei Möglichkeiten: die beitragsfreie Familienversicherung und die freiwillige Versicherung bei der gesetzlichen Krankenkasse. Die beitragsfreie Familienversicherung ist möglich, wenn die Mitarbeiter verheiratet oder verpartnert sind und deren Ehe- oder Lebenspartner gesetzlich versichert ist. Die beitragsfreie Familienversicherung setzt voraus, dass die betroffene Person während ihres unbezahlten Urlaubs im Jahr 2025 höchstens 535 Euro (im Rahmen eines Minijobs 556 Euro) monatliches Einkommen erzielt. Andernfalls besteht die Möglichkeit der freiwilligen Versicherung. Der zu zahlende Beitrag hängt von den erzielten monatlichen Einkünften ab. Im Jahr 2025 beträgt der Mindestbeitrag zur Krankenversicherung monatlich 205,35 Euro. Hinzu kommt der Beitrag zur Pflegeversicherung von mindestens 44,94 Euro bzw. 52,43 Euro für kinderlose Mitglieder ab dem 23. Lebensjahr. Dieser Betrag kann sich abhängig von der Zahl der Kinder noch reduzieren.
Fazit
Der digitale Umbruch der Arbeitswelt bringt neue Aufgaben, Chancen und Herausforderungen hervor, damit zeitliche Flexibilität im beiderseitigen Interesse von Mitarbeitern und Betrieben sinnvoll gestaltet und effektiv genutzt werden kann. Dabei werden die oben beschriebenen Arbeitszeiten über Arbeitszeitkonten (kurzfristig) und Wertguthabenvereinbarungen (langfristig) verarbeitet und zielgenau für bezahlte Freistellungen ohne Verlust des Versicherungsschutzes genutzt. Für Arbeitgeber bieten sie eine Chance, ihre Attraktivität zu steigern, die Unternehmenstreue zu erhöhen und die Leistungsbereitschaft zu fördern. Erfolgreiche Unternehmen ermöglichen Auszeiten für Fach- und Führungskräfte und gestalten diese im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben effektiv und nützlich für die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter und den betrieblichen Erfolg.
Raschid Boubba, MCGB GmbH