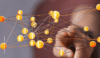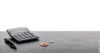Im Blick: Lohnsteuerrecht
Das Investitionssofortprogramm bringt steuerliche Entlastungen, fördert E-Mobilität und Forschung und reformiert bAV und Lohnsteuerverfahren.
Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts – Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt
Mit dem nun im Bundesgesetzblatt veröffentlichten „Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland“ setzt der Gesetzgeber ein deutliches Zeichen für Wachstum, Modernisierung und Standortsicherung. Nach der Zustimmung von Bundestag und Bundesrat wurde das Maßnahmenpaket als eines der ersten Vorhaben der neuen Bundesregierung auf den Weg gebracht. Ziel ist es, unternehmerische Investitionen steuerlich zu fördern und konkrete Anreize für Zukunftstechnologien und nachhaltige Mobilität zu schaffen.
Auch für die Lohn- und Gehaltsabrechnung ergeben sich durch das Inkrafttreten des Gesetzes greifbare Änderungen – etwa im Bereich der privaten Nutzung von Elektrofahrzeugen durch Arbeitnehmer.
Anhebung der Bruttolistenpreisgrenze auf 100.000 Euro
Ein zentrales Element des neuen Gesetzes ist die Anhebung der Bruttolistenpreisgrenze für steuerbegünstigte Elektrofahrzeuge von bisher 70.000 Euro auf 100.000 Euro. Diese Änderung betrifft die Bewertung des geldwerten Vorteils bei der privaten Nutzung rein elektrisch betriebener Fahrzeuge sowie von Brennstoffzellenfahrzeugen. Für betroffene Fahrzeuge darf weiterhin lediglich ein Viertel des Bruttolistenpreises als Bemessungsgrundlage angesetzt werden.
Für die Entgeltabrechnung bedeutet dies eine spürbare steuerliche Entlastung bei der Bewertung des geldwerten Vorteils. Gleichzeitig gilt die neue Preisgrenze ausschließlich für Fahrzeuge, die nach dem Inkrafttreten des Gesetzes neu angeschafft oder geleast werden – eine rückwirkende Anwendung ist gesetzlich ausgeschlossen.
Betriebliche E-Mobilität: Investitionsbooster mit 75 Prozent Abschreibung
Mit einem gezielten Investitionsanreiz für Unternehmen soll die betriebliche Elektromobilität zusätzlich gefördert werden. Das Gesetz ermöglicht eine beschleunigte Abschreibung von 75 Prozent der Anschaffungskosten für betrieblich genutzte Elektrofahrzeuge bereits im Jahr der Investition. Diese Regelung gilt für reine E‑Fahrzeuge, die nach dem 30.06.2025 und vor dem 01.01.2028 neu angeschafft werden. Die Abschreibung eines Fahrzeugs spielt für den Arbeitnehmer insbesondere dann eine Rolle, wenn der geldwerte Vorteil aus der privaten Nutzung über die Fahrtenbuchmethode ermittelt wird oder die sogenannte Kostendeckelung greift. Nach Auffassung der Finanzverwaltung ist die Abschreibung in diesen Fällen jedoch weiterhin gleichmäßig, also linear, auf eine Nutzungsdauer von acht Jahren zu verteilen. Die vom Arbeitgeber zulässigen erhöhten Abschreibungen bleiben dabei unberücksichtigt.
Degressive Abschreibung als Konjunkturimpuls
Mit der Wiedereinführung und Ausweitung der degressiven Abschreibung gemäß § 7 Abs. 2 EStG sollen Investitionen in bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens beschleunigt werden. Voraussetzung ist, dass die betreffenden Wirtschaftsgüter nach dem 30.06.2025 angeschafft oder hergestellt werden. Unternehmen erhalten damit in den Anfangsjahren eine erhöhte Abschreibungsbasis, was kurzfristig Liquidität bindet und Investitionen in wirtschaftlich unsicheren Zeiten attraktiver macht.
Schrittweise Entlastung bei Körperschaftsteuer und Thesaurierung
Der Gesetzgeber plant zudem eine mehrjährige Absenkung des Körperschaftsteuersatzes (§ 23 Abs. 1 Körperschaftsteuergesetz (KStG)). Beginnend ab dem 01.01.2028 soll der Steuersatz von derzeit 15 Prozent schrittweise auf 10 Prozent im Jahr 2032 sinken. Parallel erfolgt eine Absenkung des Thesaurierungssteuersatzes nach § 34a EStG: von aktuell 28,25 Prozent auf 27 Prozent (Veranlagungszeiträume 2028/2029), 26 Prozent (2030/2031) und ab 2032 auf 25 Prozent. Ziel ist die Stärkung der Eigenkapitalbasis insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen.
Ausweitung der steuerlichen Forschungsförderung
Ergänzt wird das Paket durch eine erweiterte Fassung des Forschungszulagengesetzes (§ 3 FZulG). Die Forschungszulage wird damit auch für breitere Projektkategorien und höhere Bemessungsgrundlagen geöffnet. Vor allem forschende Mittelständler sollen durch den erleichterten Zugang zur Förderung gestärkt und zur Entwicklung innovativer Technologien motiviert werden.
Fazit
Mit dem erfolgreichen Gesetzgebungsverfahren und der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt ist das steuerliche Investitionssofortprogramm nun rechtlich wirksam. Es setzt gezielt Anreize für Investitionen, Eigenkapitalbildung, Forschung und emissionsfreie Mobilität – mit unmittelbaren Auswirkungen auf Unternehmen und die Entgeltabrechnung. Die praktische Umsetzung in der Lohnpraxis verlangt eine sorgfältige Beachtung der zeitlichen Anwendungsgrenzen und der technischen Voraussetzungen, insbesondere bei der Bewertung geldwerter Vorteile und der Dokumentation neuer Abschreibungsoptionen. Die klare steuerliche Förderung der betrieblichen E-Mobilität zeigt: Der Gesetzgeber will Investitionen nicht nur ermöglichen, sondern aktiv beschleunigen.
Elektronischer Datenaustausch zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung
Ab dem 01.01.2026 wird der Lohnsteuerabzug für privat kranken- und pflegeversicherte Arbeitnehmer vollständig digitalisiert. Künftig übermitteln die Versicherungsunternehmen die relevanten Beitragsdaten direkt an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt), das daraus die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) bildet und den Arbeitgebern bereitstellt. Papierbescheinigungen werden grundsätzlich nicht mehr anerkannt. Arbeitgeber dürfen nur noch die bereitgestellten ELStAM verwenden, sind aber weiterhin verpflichtet, zu prüfen, ob die Voraussetzungen für steuerfreie Zuschüsse vorliegen. Korrekturen und Stornierungen müssen unverzüglich umgesetzt werden, auch nach dem Ende eines Arbeitsverhältnisses. Für Sonderfälle ist ein befristetes Ersatzverfahren vorgesehen. Bei ausländischen Versicherungen erfolgt keine ELStAMBereitstellung; hier sind manuelle Prüfungen erforderlich. Die Verantwortung für die Richtigkeit der Daten liegt bei den Versicherungsunternehmen – die Arbeitgeber haften nur für Fehler bei der Umsetzung.
Weitere Details und eine umfassende Darstellung der Arbeitgeberpflichten im neuen elektronischen Verfahren zur Berücksichtigung privater Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge finden Sie im ausführlichen Beitrag auf den Seiten 50 bis 51 dieses Hefts.
Der Referentenentwurf zum 2. Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG II)
Einordnung und Überblick zu den geplanten Neuerungen im Arbeits-, Aufsichts- und Steuerrecht
Trotz eines leichten Anstiegs auf rund 18,1 Millionen Beschäftigte mit aktiver bAV-Anwartschaft stagniert die Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung (bAV) in der Breite – insbesondere bei kleineren Betrieben und Geringverdienenden bleibt sie unterdurchschnittlich. Der nun vorgelegte Referentenentwurf zum 2. Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG II) knüpft an die Reform von 2018 an und verfolgt das Ziel, die bAV umfassend weiterzuentwickeln: mit verbesserten Rahmenbedingungen, neuen Anreizen und deutlich mehr Flexibilität.
Arbeitsrechtliche Neuerungen
Sozialpartnermodell 2.0
Die im Jahr 2018 eingeführte reine Beitragszusage auf tarifvertraglicher Grundlage hat erste Praxisbeispiele hervorgebracht. BRSG II will nun den Durchbruch ermöglichen: Künftig sollen bestehende Sozialpartnermodelle für alle Arbeitsverhältnisse geöffnet werden können, die in den Zuständigkeitsbereich der beteiligten Gewerkschaften fallen. Zudem wird es den Tarifparteien erleichtert, sich einem bestehenden Modell anzuschließen. Auch die Genehmigungsverfahren werden vereinfacht, um bürokratische Hürden zu reduzieren. Die Mitnahme von Anwartschaften bei einem Arbeitgeberwechsel – sowohl innerhalb eines Sozialpartnermodells als auch zwischen verschiedenen Modellen – wird verbessert. Dies erhöht die Portabilität der betrieblichen Altersversorgung deutlich.
Opting-out auf Betriebsebene
Die Möglichkeit der automatischen Entgeltumwandlung mit Widerspruchsrecht (Opting-out) soll ausgeweitet werden. Künftig können Arbeitgeber solche Systeme auch ohne tarifvertragliche Grundlage einführen, sofern sie sich finanziell in besonderem Maße beteiligen. Damit eröffnet sich eine neue Option insbesondere für Unternehmen ohne Tarifbindung, die Beschäftigten einen einfachen Zugang zur bAV bieten wollen.
Flexibilisierung der Abfindungsregelung
Auch das Abfindungsrecht wird modernisiert: Die Abfindungsgrenze wird erhöht, wenn das angesparte Kapital mit Zustimmung der Beschäftigten in die gesetzliche Rentenversicherung eingebracht wird. Darüber hinaus wird im Fall der Liquidation einer Pensionskasse eine gesetzliche Fiktion der Abfindung vorgesehen, um eine zügige Abwicklung zu ermöglichen.
Vorzeitiger Betriebsrentenbezug
An die neue Flexibilisierung des Hinzuverdienstrechts in der gesetzlichen Rentenversicherung wird auch das Betriebsrentengesetz angepasst. Beschäftigte können künftig vorzeitig eine Betriebsrente mit Abschlägen beziehen, auch wenn sie lediglich eine Teilrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten.
Finanzaufsichtsrechtliche Neuerungen
Pensionskassen
Im Finanzaufsichtsrecht wird es Pensionskassen künftig gestattet, höhere Leistungen bei vorzeitigem Leistungsbezug zu gewähren. Die Definition der Pensionskasse im Versicherungsaufsichtsgesetz wird entsprechend angepasst. Zudem dürfen Pensionskassen ihr Sicherungsvermögen temporär in einem Toleranzbereich unter den Verpflichtungen führen. Diese Erleichterung bei der Bedeckung ermöglicht flexiblere Kapitalanlagen und eine bessere Nutzung der regulatorischen Spielräume.
Pensionsfonds
Pensionsfonds erhalten die Möglichkeit, Kapitalleistungen auch in Raten auszuzahlen. Darüber hinaus werden innerhalb von Sozialpartnermodellen die Möglichkeiten zur Bildung von Kapitalpuffern erweitert. Dies schafft Spielräume für chancenorientierte Anlagestrategien, ohne dass dies zu spürbaren Schwankungen bei den Rentenzahlungen führt.
Steuerrechtliche Änderungen
Förderbetrag für Geringverdienende (§ 100 EStG)
Bei der steuerlichen Förderung der bAV für Geringverdienende wird eine Dynamisierung der Einkommensgrenze eingeführt, indem diese künftig an die Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung gekoppelt wird. Gleichzeitig wird der maximal förderfähige Betrag angehoben, um den finanziellen Anreiz für Arbeitgeber weiter zu verstärken.
Im Detail sieht der Gesetzentwurf eine Neufassung von § 100 Absatz 3 Nummer 3 vor: Begünstigt sind nun ausdrücklich Beschäftigte, deren monatlicher laufender Arbeitslohn (§ 39b Abs. 2 Satz 1 und 2 EStG), pauschal besteuerter Arbeitslohn (§ 40a Abs. 1 und 3 EStG) oder pauschal besteuertes Arbeitsentgelt (§ 40a Abs. 2 und 2a EStG) im Zeitpunkt der Beitragsleistung nicht mehr als drei Prozent der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung beträgt. Diese Arbeitslohngrenze wird für andere Lohnzahlungszeiträume entsprechend umgerechnet: bei täglicher Zahlung mit dem Faktor 1/30, bei wöchentlicher mit 7/30 und bei jährlicher Zahlung mit dem Faktor 12.
Zudem wird in § 100 Absatz 6 Satz 1 die Förderhöchstgrenze angehoben: Der bisherige Betrag von 960 Euro jährlich wird auf 1.200 Euro erhöht. Damit wird der Förderbetrag nicht nur dynamisiert, sondern auch in seiner finanziellen Wirkung spürbar verbessert.
Steuerliche Begleitung der Abfindungsflexibilisierung
Die steuerrechtlichen Änderungen flankieren die neue Abfindungsregelung: Wird eine Kleinbetragsrente abgefunden und in die gesetzliche Rentenversicherung übertragen, bleibt diese Zahlung steuerfrei. Die spätere Auszahlung der gesetzlichen Rente unterliegt dann wie üblich der nachgelagerten Besteuerung.
Weitere begleitende Regelungen
Auch in angrenzenden Regelungsbereichen wird nachjustiert: Direktversicherungen können künftig nach allen Beschäftigungszeiten, in denen kein Arbeitsentgelt bezogen wurde, zu den ursprünglich vereinbarten Bedingungen fortgeführt werden. Dies verbessert insbesondere bei unterbrochenen Erwerbsbiografien die Kontinuität der Altersversorgung. Außerdem wird klargestellt, dass Sonderzahlungen von Arbeitgebern an Pensionskassen, die dem Zweck dienen, Rentenkürzungen zu vermeiden, nicht als beitragspflichtiges Arbeitsentgelt in der Sozialversicherung gelten.
Zudem wird die Verwaltungspraxis des Pensions-SicherungsVereins modernisiert: Die Kommunikation mit Leistungsberechtigten kann künftig über ein Internetportal erfolgen. Beitragsbescheide dürfen automatisiert erstellt werden, und der elektronische Datenabgleich mit der gesetzlichen Rentenversicherung sowie der Bundesagentur für Arbeit wird erleichtert und datenschutzrechtlich fundiert ausgestaltet.
Fazit
Das BRSG II verfolgt einen klugen Dreiklang aus Vereinfachung, Digitalisierung und gezielter Anreizsetzung. Es rückt die bAV stärker in die Mitte der Altersvorsorge und nimmt zugleich die Betriebe in die Pflicht – insbesondere solche, die bisher zurückhaltend agierten. Sollte es dem Gesetzgeber gelingen, insbesondere das Sozialpartnermodell durch Praxistauglichkeit und einen breiten Zugang zu etablieren, könnte das BRSG II zum dringend benötigten Impuls für mehr Verbreitung und Qualität der betrieblichen Altersversorgung werden.
Geplante Steuerentlastungen für Arbeitnehmer: Union legt Eckpunkte vor
Die Unionsfraktion hat ein steuerpolitisches Eckpunktepapier vorgestellt, das auf umfassende Entlastungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern abzielt. Auch wenn ein konkreter Gesetzentwurf noch aussteht, zeichnen sich bereits mehrere zentrale Reformvorschläge ab, die bei einer Umsetzung sowohl steuerliche Entlastungen bringen als auch arbeitsmarktpolitische Impulse setzen könnten.
Ein wesentlicher Bestandteil ist die geplante Erhöhung der Entfernungspauschale. Ab dem 01.01.2026 soll diese dauerhaft auf 38 Cent pro Kilometer angehoben werden – und zwar ab dem ersten Entfernungskilometer. Damit würde eine langjährige Forderung nach einer realistischeren Berücksichtigung von Pendlerkosten umgesetzt.
Darüber hinaus ist die Einführung einer sogenannten Arbeitstagepauschale vorgesehen. Diese soll künftig verschiedene bisher getrennte Pauschalen – insbesondere die Entfernungspauschale, die Homeoffice-Pauschale sowie Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer – in einer einheitlichen Regelung zusammenfassen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen künftig für jeden Tag beruflicher Vollzeitbeschäftigung eine pauschale Berücksichtigung als Werbungskosten geltend machen können – unabhängig vom Arbeitsort.
Ein weiteres Instrument betrifft die Einführung einer steuerfreien Teilzeitaufstockungsprämie. Künftig sollen Arbeitgeber die Möglichkeit erhalten, teilzeitbeschäftigten Mitarbeitenden eine steuerfreie Prämie zu gewähren, wenn diese ihre regelmäßige Wochenarbeitszeit dauerhaft erhöhen. Die Prämie kann wahlweise als Geld- oder Sachzuwendung erfolgen und beträgt bis zu 225 Euro je zusätzlich vereinbarter Wochenstunde. Insgesamt ist die Prämie auf maximal 4.500 Euro begrenzt. Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist, dass die Aufstockung der Arbeitszeit mindestens 24 Monate andauert. Ausgeschlossen sind Fälle befristeter Teilzeit oder Beschäftigungen mit einer verbleibenden Laufzeit von weniger als zwei Jahren. Auch wenn in den 12 Monaten vor der Arbeitszeiterhöhung eine Reduzierung der Stunden erfolgte, greift die Steuerbegünstigung nicht.
Ein weiterer steuerlicher Entlastungsvorschlag betrifft Überstundenzuschläge. Künftig sollen Zuschläge für Mehrarbeit steuerfrei gestellt werden, sofern sie über die tariflich vereinbarte beziehungsweise an Tarifverträgen angelehnte regelmäßige Vollzeitarbeit hinausgehen. Als Vollzeit gelten nach den Vorstellungen der Union mindestens 34 Wochenstunden in tarifgebundenen und 40 Wochenstunden in nicht tarifgebundenen Beschäftigungsverhältnissen. Die Steuerfreiheit soll auf Zuschläge in Höhe von bis zu 25 Prozent des Überstundengrundlohns beschränkt sein. Der Grundlohn muss dabei dem regulären Arbeitsentgelt entsprechen.
Ein weiterer Eckpunkt ist die Einführung einer sogenannten Aktivrente. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nach Erreichen des gesetzlichen Rentenalters freiwillig weiterarbeiten, sollen künftig bis zu 2.000 Euro monatlich steuerfrei hinzuverdienen dürfen. Der Freibetrag soll zusätzlich zum Grundfreibetrag gewährt werden und sowohl Einkünfte aus selbstständiger als auch aus nicht selbstständiger Tätigkeit umfassen – vorausgesetzt, die reguläre Altersversorgung läuft weiter.
Für die Praxis Auch wenn es sich bei den Vorschlägen bislang um politische Absichtserklärungen handelt, könnten die Maßnahmen – sofern umgesetzt – zu spürbaren steuerlichen Erleichterungen für Arbeitnehmer führen. Insbesondere gezielte Anreize für längere Erwerbsbeteiligung, die Ausweitung der Arbeitszeit in Teilzeitverhältnissen sowie flexiblere Arbeitsmodelle stehen im Fokus. Die konkrete Ausgestaltung in Form von Gesetzesentwürfen bleibt abzuwarten. Über den Fortgang des Gesetzgebungsverfahrens halten wir Sie selbstverständlich auf dem Laufenden.
Keine Pflicht zur Schattenveranlagung durch das Betriebsstättenfinanzamt bei fehlerhaftem Lohnsteuerabzug für beschränkt Steuerpflichtige
Finanzgericht Niedersachsen, Urteil vom 16.04.2025 – 9 K 155/22
Das Finanzgericht Niedersachsen hatte sich jüngst mit der Frage zu befassen, ob das für die Betriebsstätte zuständige Finanzamt verpflichtet ist, bei fehlerhaft berechneter Lohnsteuer von beschränkt steuerpflichtigen Arbeitnehmern eine sogenannte Schattenveranlagung vorzunehmen. Hintergrund des Verfahrens war der Fall einer GmbH, die für zwei in den Niederlanden wohnhafte Mitarbeiter die Lohnsteuer nicht – wie vorgeschrieben – nach Steuerklasse VI, sondern nach Steuerklasse I abgeführt hatte.
Im Rahmen einer späteren Lohnsteuer-Außenprüfung erließ das Finanzamt einen Haftungsbescheid und machte darin Lohnsteuer sowie weitere Abzugsbeträge für den Zeitraum von Januar 2016 bis Dezember 2019 geltend. Die GmbH widersprach dem Bescheid mit der Begründung, die tatsächliche Einkommensteuerschuld der betroffenen Arbeitnehmer sei niedriger gewesen. Diese Behauptung wurde durch vorgelegte Einkommensteuerbescheide und Berechnungen untermauert. Das Finanzamt erkannte daraufhin lediglich für das Jahr 2016 sowie für das Jahr 2019 im Fall einer der beiden Arbeitnehmerinnen eine geringere Haftung an. Für die Jahre 2017 und 2018 verweigerte es eine Korrektur unter Hinweis auf die bereits eingetretene Festsetzungsverjährung. Zudem lehnte es ab, sogenannte Schattenveranlagungen auf Grundlage der vorgelegten Unterlagen durchzuführen.
Das Finanzgericht bestätigte die Auffassung des Finanzamts. Es stellte klar, dass sich die Arbeitgeberhaftung ausschließlich auf die Jahreslohnsteuer im Sinne des § 38a Abs. 1 Satz 1 EStG beziehe. Maßgeblich sei nicht die tatsächlich festgestellte oder hypothetisch errechnete Einkommensteuerschuld des Arbeitnehmers. Eine Haftung nach § 42d Abs. 1 Nr. 1 und 3 EStG erfasse lediglich die Lohnsteuer, die vom Arbeitgeber einzubehalten und abzuführen gewesen wäre. Selbst wenn nachträglich eine geringere Steuerlast der Arbeitnehmer festgestellt oder nachvollziehbar dargelegt werde, ändere dies nichts an der bestehenden Haftung.
Das Gericht betonte, dass das Einkommensteuergesetz ausdrücklich zwischen dem Lohnsteuerabzug und der Einkommensteuerveranlagung unterscheide. Eine Durchbrechung dieser Systematik, etwa durch eine vom Betriebsstättenfinanzamt vorzunehmende Schattenveranlagung zur Ermittlung einer möglicherweise geringeren Einkommensteuerschuld, sei weder gesetzlich vorgesehen noch sachlich gerechtfertigt. Auch aus verfassungsrechtlicher Sicht sei eine solche Maßnahme nicht erforderlich. Die Haftung des Arbeitgebers diene nicht der Sanktionierung, sondern der Sicherung des Steueraufkommens, sodass eine strafähnliche Wirkung nicht unterstellt werden könne.
Die Entscheidung des Finanzgerichts ist noch nicht rechtskräftig. Die Revision wurde zugelassen und ist derzeit unter dem Aktenzeichen VI R 8/25 beim Bundesfinanzhof anhängig.
Markus Stier