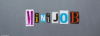Kein Unterschied zum Vollzeitbeschäftigten : Arbeitsrecht für Minijobber
Immer wieder werden Personen, die eine geringfügige Beschäftigung ausüben, als Arbeiternehmer zweiter Klasse behandelt. Dabei stehen alle Minijobber in einem regulären Arbeitsverhältnis. Beim Arbeitsrecht gibt es keinen Unterschied zwischen einem Vollzeit- und einem Teilzeitbeschäftigten. Trotzdem kommt es vor, dass Aushilfen im Urlaub keinen Lohn, bei Krankheit keine Lohnfortzahlung und für die ausgefallene Arbeit an einem Feiertag kein Entgelt bekommen. Oftmals müssen sie die ausgefallene Arbeit auch nachholen.
Viele Aushilfen fühlen sich nicht selten wie Arbeitnehmer zweiter Klasse. In der Praxis haben geringfügig Beschäftigte die gleichen Rechte und Pflichten wie Vollzeitbeschäftigte. Die Rechte und Pflichten können sich aus Gesetzen, einem Tarifvertrag oder einer Betriebsvereinbarung ergeben. Üben Arbeitnehmer einen Minijob aus, gelten sie nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) als Teilzeitbeschäftigte. Nach den Bestimmungen des TzBfG stehen den Teilzeitbeschäftigten die gleichen Rechte wie den Vollzeitbeschäftigten zu.
Schriftliche Vereinbarung erforderlich
In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer keine schriftlichen Arbeitsverträge geschlossen werden. Nachteile ergeben sich vor allem für die Beschäftigten. Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Nachweisgesetz (NachwG) ist eine schriftliche Vereinbarung zwingend vorgeschrieben, meist wird ein Arbeitsverhältnis mit einem Minijobber aber nur mündlich vereinbart. Eine Ausnahme gilt für befristete Arbeitsverträge, hier ist die Schriftform zwingend. Die schriftliche Vereinbarung sollte die Hauptpflichten der Vertragspartner und die darüber hinausgehenden Zusatzvereinbarungen beinhalten. Liegt kein schriftlicher Arbeitsvertrag vor, ist der Arbeitgeber verpflichtet, spätestens einen Monat nach Beginn des Arbeitsverhältnisses einen schriftlichen Nachweis über die wesentlichen Bedingungen auszustellen.
Der schriftliche Nachweis soll die nachfolgenden Angaben enthalten:
- Name und Anschrift der Vertragsparteien,
- Beginn (bei befristeten Arbeitsverhältnissen die voraussichtliche Dauer) des Arbeitsverhältnisses,
- Arbeitsort,
- Art der Tätigkeit,
- Zusammensetzung, Höhe und Fälligkeit des Arbeitsentgelts (einschließlich Zuschläge, Zulagen, Prämien, Sonderzahlungen sowie anderer Bestandteile),
- Arbeitszeit,
- Dauer des Erholungsurlaubs,
- Kündigungsfristen und
- Hinweise auf geltende Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen.
Pflichten des Arbeitgebers
Typische Pflichten des Arbeitgebers sind
- die Vergütungspflicht,
- die Pflicht zur Gewährung von Erholungsurlaub,
- die Fürsorgepflicht für Leben und Gesundheit des Arbeitnehmers,
- die Pflicht zur Zeugniserteilung nach einer Kündigung und
- die Beachtung des Gleichbehandlungsprinzips.
Pflichten des Arbeitnehmers
Typische Pflichten des Arbeitnehmers sind
- die Pflicht, die vereinbarte Arbeitsleistung zu erbringen,
- die Treupflicht,
- die Verschwiegenheitspflicht,
- die Schadensanzeige- und Schadensabwendungspflicht,
- die Betriebsfriedenswahrungspflicht und
- die Verpflichtung, für den Betrieb dringend erforderliche Mehrarbeit zu leisten.
Kein Unterschied zwischen Teilzeit und Vollzeit
Die Gleichstellung gilt zwischen teilzeit- und vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmern bei den nachfolgend aufgezählten Punkten:
- Gleichbehandlung von Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigten,
- schriftlicher Arbeitsvertrag/Niederschrift der vereinbarten wesentlichen Arbeitsbedingungen,
- Erholungsurlaub,
- Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Arbeitsausfall an Feiertagen,
- Sonderzahlungen/Gratifikationen und
- Kündigungsschutz.
Keine Benachteiligung gegenüber Vollzeitbeschäftigten
Geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer sind gegenüber vollzeitbeschäftigten Mitarbeitern gleich zu behandeln (§ 4 TzBfG). Dies gilt für alle Maßnahmen des Arbeitgebers. Es gibt Ausnahmen, die können in der Arbeitsleistung, Qualifikation, Berufserfahrung und der unterschiedlichen Arbeitsplatzanforderung begründet sein (Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 25.10.1994, Az.: 3 AZR 149/94).
Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub
In der Praxis kommt es nicht selten vor, dass Aushilfen mitgeteilt wird, dass sie keinen Urlaubsanspruch haben. Oftmals müssen Aushilfen ihren Urlaub vorher hereinarbeiten. Viele Minijobber haben keine Kenntnis, dass ihnen ein bezahlter Urlaub zusteht (Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 21.10.1965, Az.: 5 AZR 146/65). Für alle Arbeitnehmer beträgt der gesetzliche Mindesturlaubsanspruch bei einer Fünf-Tage-Woche jährlich 20 Werktage. Bei einer Sechs-Tage-Woche sind es 24 Werktage pro Jahr (§ 3 Bundesurlaubsgesetz). Bei einem geringfügig Beschäftigten, der keine fünf Tage in der Woche arbeitet, ist der Erholungsurlaub umzurechnen. Erhalten Vollzeitkräfte mehr Urlaub als im Bundesurlaubsgesetz vorgesehen, steht das auch den Minijobbern zu. Was den Urlaub betrifft, dürfen Teilzeitkräfte nicht ohne sachlichen Grund benachteiligt werden.
Formel für die Berechnung des Urlaubsanspruchs:
Wochenarbeitstage × 20 (Urlaubsanspruch in Werktagen) / 5 (übliche Arbeitstage, Montag bis Freitag) = Urlaubstage
oder
Wochenarbeitstage × 24 (Urlaubsanspruch in Werktagen) / 6 (übliche Arbeitstage, Montag bis Samstag) = Urlaubstage
Praxishinweis
Bruchteile von Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag ergeben, werden auf volle Urlaubstage aufgerundet.
Bruchteile von Urlaubstagen, die nicht bei der Berechnung von Teilurlaub aufgerundet werden müssen, weil sie keinen halben Tag erreichen, sind durch stundenweise Befreiung von der Arbeitspflicht zu gewähren oder nach dem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis abzugelten.
Beispiel:
Ein Automechaniker arbeitet nebenher als Minijobber in einem Autohaus. Im Betrieb erhalten Vollzeitbeschäftigte bei einer Fünf-Tage-Woche 20 bezahlte Urlaubstage gemäß den Bestimmungen des Bundesurlaubsgesetzes. Der Minijobber arbeitet an zwei Tagen in der Woche.
Lösung:
Der aushilfsbeschäftigte Automechaniker hat einen Anspruch auf acht bezahlte Urlaubstage pro Jahr. Formel: 2 Wochenarbeitstage × 20 Werktage / 5 = 8 anteilige Urlaubstage
Auch Minijobber haben einen zusätzlichen Urlaubsgeldanspruch
Oftmals erhalten Arbeitnehmer, wenn sie in den Urlaub gehen, ein zusätzliches Urlaubsgeld. Bekommen Vollzeitbeschäftigte in einem Betrieb dieses zusätzliche Urlaubsgeld, steht dieses auch anteilmäßig den Teilzeitkräften zu. Aushilfen dürfen auch hier nicht benachteiligt werden. Die Höhe des zusätzlichen Urlaubsgeldes richtet sich dabei nach der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit. Allerdings ist bei der Gewährung des zusätzlichen Urlaubsgeldes zu beachten, dass dadurch nicht die Geringfügigkeitsgrenze in der Sozialversicherung überschritten wird.
Ulrich Frank, Sozialversicherungsfachwirt und Wirtschaftsjournalist