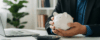Im Blick: Lohnsteuerrecht
Ab 2026 treten zahlreiche steuerliche Änderungen in Kraft, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen betreffen. Das neue Aktivrentengesetz führt eine steuerfreie Aktivrente für Beschäftigte über der Regelaltersgrenze ein. Außerdem werden Entfernungspauschale und Ehrenamtsfreibeträge erhöht, und Beiträge zur privaten Krankenversicherung künftig automatisch über das ELStAM-System erfasst. Arbeitgeber sollten sich frühzeitig auf die neuen Pflichten und Prozesse vorbereiten.
Aktivrentengesetz ab 2026
Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer steuerfreien Aktivrente soll ein neues Instrument geschaffen werden, um eine längere Erwerbstätigkeit steuerlich zu begünstigen.
Vorgesehen ist, dass sozialversicherungspflichtige Einnahmen aus einer Beschäftigung nach Erreichen der Regelaltersgrenze bis zu einem Betrag von monatlich 2.000 Euro steuerfrei gestellt werden. Die steuerfreie Aktivrente soll in § 3 Nr. 21 des Einkommensteuergesetzes (EStG) aufgenommen werden. Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist, dass die betreffende Person das reguläre Rentenalter erreicht hat, weiterhin arbeitet und der Arbeitgeber auf den gezahlten Lohn Rentenversicherungsbeiträge entrichtet. Dabei gilt ausdrücklich: Auch wenn Rentenzahlungen bezogen werden, ist dies keine Voraussetzung für die Anwendung des Freibetrags. Eine Prüfung oder Dokumentation durch den Arbeitgeber, ob Rentenzahlungen tatsächlich fließen, ist nicht vorgesehen.
Die Einnahmen bleiben jedoch beitragspflichtig zur Sozialversicherung. Arbeitnehmer zahlen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, während Arbeitgeber zusätzlich auch Beiträge zur Arbeitslosen- und Rentenversicherung leisten müssen. Nicht in den Anwendungsbereich fallen geringfügig Beschäftigte sowie Beamte, die keine gesetzliche Regelaltersrente, sondern eine Pension beziehen.
Die steuerfreien Einnahmen sollen nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen. Damit ist sichergestellt, dass diese Einkünfte den Steuersatz auf andere Einkünfte, insbesondere Rentenzahlungen, nicht erhöhen. Ausgeschlossen von der Steuerfreiheit sind jedoch bestimmte Einnahmearten. Dazu zählen unter anderem Ruhegelder, Wartgelder, Witwen- und Waisengelder sowie sonstige Bezüge aus früheren Dienstverhältnissen nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG, da sie nicht auf einer aktiven Tätigkeit beruhen. Ebenso fallen laufende Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung sowie Sonderzahlungen nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG nicht unter die Begünstigung.
Für die Anwendung der Steuerbefreiung sind bestimmte Dokumentationspflichten vorgesehen. Beschäftigte haben dem Arbeitgeber schriftlich zu bestätigen, dass der Freibetrag nicht bereits in einem anderen Dienstverhältnis berücksichtigt wird. Dies ist insbesondere dann relevant, wenn etwa für eine Betriebsrente die Steuerklassen I bis V angewendet werden, obwohl es sich faktisch nicht um das erste Dienstverhältnis handelt. Eine solche Bestätigung ist vom Arbeitgeber aufzubewahren und zum Lohnkonto zu nehmen.
Die Steuerfreiheit soll bereits im Rahmen des Lohnsteuerabzugs berücksichtigt werden, wobei die Freigrenze bei monatlich 2.000 Euro liegt. Es handelt sich um einen Freibetrag, das bedeutet, dass Beträge oberhalb dieser Grenze regulär zu versteuern sind. Die steuerfreien Beträge müssen im Rahmen der Jahreslohnsteuerbescheinigung nach § 41b Abs. 1 EStG ausgewiesen werden. Das Inkrafttreten der Steuerfreiheit ist für den 01.01.2026 geplant, das entsprechende Gesetzgebungsverfahren soll noch vor Jahresende abgeschlossen werden. Das Bundeskabinett hat dem Entwurf zugestimmt und auch die Zustimmung des Bundestages ist wohl nur reine Formsache.
Neben dem Entwurf zur Aktivrente existieren auch zwei weitere steuerpolitische Vorschläge, die sich derzeit in der Diskussion befinden (wir haben in der letzten Ausgabe über den Entwurf des Arbeitsmarktstärkungsgesetzes berichtet). Diese betreffen die steuerfreie Behandlung von Überstundenzuschlägen sowie die Einführung einer steuerfreien Prämie bei der Aufstockung der Arbeitszeit.
Im ersten Fall sollen Arbeitgeber die Möglichkeit erhalten, Überstundenzuschläge künftig steuerfrei zu gewähren. Dafür soll § 3b Abs. 4b EStG neu eingeführt werden. Voraussetzung ist, dass die Überstunden über die im Arbeits- oder Tarifvertrag vereinbarte Normalarbeitszeit hinausgehen. Die Steuerbefreiung ist ausgeschlossen, wenn die Arbeitszeit in den zwölf Monaten vor den geleisteten Überstunden verringert wurde. Eine Ausnahme besteht, sofern die Reduzierung der Arbeitszeit vor dem 01.07.2025 vereinbart wurde. Der steuerfreie Zuschlag darf höchstens 25 Prozent des maßgeblichen Grundlohns betragen.
Die zweite geplante Maßnahme betrifft eine steuerfreie Prämie, die Beschäftigten gezahlt werden kann, wenn sie ihre Arbeitszeit dauerhaft erhöhen. Grundlage soll § 3 Nr. 73 EStG bilden. Die Prämie darf sich auf bis zu 225 Euro pro aufgestockter Wochenstunde belaufen, wobei ein maximaler Steuerfreibetrag in Höhe von 4.500 Euro vorgesehen ist. Die Prämie muss zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn im Sinne von § 8 Abs. 4 EStG gewährt werden. Eine dauerhafte Aufstockung wird in dem Entwurf mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten definiert. Wird die Arbeitszeit innerhalb dieses Zeitraums wieder reduziert, entfällt die Steuerfreiheit rückwirkend. In diesem Fall muss die Prämie nachversteuert werden.
Wenn eine Arbeitszeitaufstockung lediglich infolge einer regulär auslaufenden befristeten Teilzeitvereinbarung erfolgt, ist die Prämie nicht steuerfrei. Erfolgt die Rückkehr in die vorherige oder eine höhere Arbeitszeit jedoch vorzeitig, kann die Prämie steuerfrei gewährt werden, sofern die Restlaufzeit der ursprünglichen Befristung mindestens 24 Monate beträgt. Eine Steuerbefreiung ist auch dann ausgeschlossen, wenn die Reduzierung der Arbeitszeit weniger als zwölf Monate vor der Aufstockung erfolgte. Lediglich für Arbeitszeitverringerungen, die vor dem 01.07.2025 vereinbart wurden, gilt auch hier eine Ausnahme.
Mit den geplanten Regelungen soll nicht nur die Weiterarbeit im Ruhestand gefördert, sondern auch eine stärkere Arbeitszeitbindung und ein Anreiz zur Mehrarbeit geschaffen werden. Die Vorschläge knüpfen an aktuelle gesellschaftliche und arbeitsmarktpolitische Herausforderungen an. Wann und in welcher Form sie in ein Gesetzgebungsverfahren überführt werden, bleibt abzuwarten.
Steueränderungsgesetz 2025 ab dem Jahr 2026
Mit dem Steueränderungsgesetz sollen zum 01.01.2026 steuerliche Entlastungen für Unternehmen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie für gemeinnützige Organisationen und Ehrenamtliche umgesetzt werden. Der Schwerpunkt der Änderungen liegt auf der Förderung von Mobilität, Vereinfachungen für das Ehrenamt sowie Anpassungen bei der Umsatzsteuer in der Gastronomie. Die gesetzlichen Neuregelungen wirken sich unmittelbar auf die Lohn- und Gehaltsabrechnung aus.
Besonders relevant für Arbeitgeber ist die Anhebung der Entfernungspauschale. Ab dem ersten Kilometer zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte können Arbeitnehmer ab dem 01.01.2026 eine Pauschale von 38 Cent pro einfachem Kilometer geltend machen. Die bisherige Zweiteilung der Entfernungspauschale entfällt damit.
Beispiel:
Bei einem täglichen Arbeitsweg von 18 Kilometern an 220 Arbeitstagen ergibt sich künftig ein Betrag von 1.504,80 Euro jährlich. Damit wird die Werbungskostenpauschale in Höhe von 1.230 Euro überschritten.
Auch für Arbeitgeber hat die Anhebung der Entfernungspauschale Auswirkungen, wenn ein steuerbegünstigter Fahrtkostenzuschuss nach § 40 Abs. 2 Satz 2 EStG gezahlt wird. Ab 2026 kann dieser ebenfalls bis zu 38 Cent pro Kilometer betragen, muss aber zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erfolgen. Eine Gehaltsumwandlung ist ausgeschlossen. Der Zuschuss darf den Betrag nicht überschreiten, den der Arbeitnehmer als Werbungskosten geltend machen könnte. Eine Verpflichtung zur Zahlung besteht für Arbeitgeber nicht. Der Zuschuss ist mit 15 Prozent pauschaler Lohnsteuer zu versteuern und bleibt sozialversicherungsfrei. Um diesen steuerlich korrekt zu berücksichtigen, muss beim Arbeitnehmer eine erste Tätigkeitsstätte vorliegen. Zahlungen dürfen nur für tatsächliche Arbeitstage erfolgen. Krankheitstage, Urlaub oder Außendiensttage bleiben unberücksichtigt.
Die Finanzverwaltung erlaubt auf Basis eines BMF-Schreibens vom 18.11.2021 eine vereinfachte Handhabung ohne tägliche Aufzeichnungen. Wird diese Vereinfachung genutzt, können maximal 15 Tage im Monat als Arbeitstage angesetzt werden. Dies gilt allerdings nur, wenn arbeitsvertraglich festgelegt ist, dass an fünf Tagen pro Woche in Präsenz gearbeitet wird. Bei Homeoffice oder Teilzeitregelungen muss die Anzahl der Tage anteilig gekürzt werden. So wären beispielsweise bei zwei Homeoffice-Tagen pro Woche lediglich neun Zuschusstage pro Monat möglich.
Die Entfernungspauschale ist nach wie vor auf einen Jahresbetrag von 4.500 Euro begrenzt, sofern kein eigenes Fahrzeug für den Arbeitsweg genutzt wird. Diese Grenze betrifft vor allem Beschäftigte, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Der Zuschuss des Arbeitgebers bleibt nur für den Beschäftigten steuer- und sozialversicherungsfrei. Der Arbeitgeber muss die Lohnsteuer pauschal abführen und die Zahlungen in der Lohnsteuerbescheinigung unter Ziffer 18 angeben. Bei einer Einkommensteuererklärung wird der Zuschuss entsprechend angerechnet.
Eine weitere Änderung betrifft die doppelte Haushaltsführung. Auch hier gilt ab 2026 die neue Entfernungspauschale von 38 Cent ab dem ersten Kilometer. Für wöchentliche Familienheimfahrten kann der erhöhte Kilometersatz entsprechend angewendet werden.
Die Mobilitätsprämie nach § 101 Satz 1 EStG wird entfristet. Damit bleibt die steuerliche Förderung für Geringverdiener dauerhaft erhalten. Anspruchsberechtigt sind Personen, deren Einkommen unterhalb des Grundfreibetrags liegt und die deshalb von der Entfernungspauschale steuerlich nicht profitieren. Die Mobilitätsprämie wird direkt vom Finanzamt ausgezahlt und orientiert sich an der Entfernungspauschale. Durch die Entfristung wird sichergestellt, dass auch nach 2026 weiterhin eine steuerliche Entlastung für Erwerbstätige mit geringem Einkommen und weiter Entfernung zum Arbeitsplatz besteht.
Eine weitere wichtige Änderung betrifft das Ehrenamt. Im Rahmen des Steueränderungsgesetzes wird klargestellt, dass die steuerlichen Freibeträge nach § 3 Nr. 26 und 26a EStG sowohl für Körperschaften im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 9 Körperschaftsteuergesetz (KStG) als auch für juristische Personen des öffentlichen Rechts nur dann anwendbar sind, wenn die Tätigkeit der Förderung steuerbegünstigter Zwecke im Sinne der §§ 52 bis 54 der Abgabenordnung (AO) dient. Diese Klarstellung stellt sich ausdrücklich gegen ein Urteil des Bundesfinanzhofs vom 08.05.2024 und folgt der bisherigen Verwaltungsauffassung. Danach genügt nicht allein die Tätigkeit im Auftrag einer öffentlichen Einrichtung, sondern es kommt entscheidend darauf an, ob die ausgeübte Tätigkeit auch selbst steuerbegünstigten Zwecken dient. Die Neuregelung gilt in allen offenen Fällen.
Zugleich werden zum 01.01.2026 die steuerlichen Freibeträge für das Ehrenamt angehoben. Der Übungsleiterfreibetrag nach § 3 Nr. 26 EStG steigt von 3.000 auf 3.300 Euro jährlich. Dieser Freibetrag gilt für nebenberuflich tätige Personen, die als Übungsleiter, Ausbilder oder Erzieher tätig sind oder vergleichbare Tätigkeiten ausüben, sofern diese Tätigkeiten gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen. Die Tätigkeit darf maximal ein Drittel einer regulären Vollzeitstelle umfassen. Arbeitgeber müssen dokumentieren, dass alle Voraussetzungen eingehalten wurden, um die Steuerfreiheit im Rahmen einer Prüfung nachweisen zu können.
Auch die Ehrenamtspauschale nach § 3 Nr. 26a EStG wird erhöht. Künftig können bis zu 960 Euro jährlich steuer- und sozialversicherungsfrei gezahlt werden. Voraussetzung ist ebenfalls, dass es sich um eine nebenberufliche Tätigkeit im gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Bereich handelt. Die Pauschale gilt beispielsweise für ehrenamtliche Vorstandsmitglieder, Kassenwarte oder vergleichbare Tätigkeiten, die nicht unter den Übungsleiterfreibetrag fallen. Die Zahlung ist pro Person und Jahr nur einmal zulässig, auch wenn mehrere begünstigte Tätigkeiten ausgeübt werden. Arbeitgeber sollten auch hier geeignete Nachweise führen.
Der Bundesrat hat darüber hinaus zwei weitere Änderungen vorgeschlagen. Künftig soll eine Pauschalversteuerung von Betriebsveranstaltungen nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG nur noch möglich sein, wenn die Veranstaltung allen Beschäftigten offensteht. Damit würde eine bestehende Rechtsprechung gesetzlich aufgehoben. Veranstaltungen, die nur bestimmten Gruppen offenstehen, müssten dann nach § 37bEStG versteuert werden. Dies hätte auch Auswirkungen auf die Sozialversicherungspflicht der Zuwendung.
Außerdem schlägt der Bundesrat vor, die steuerfreie Erstattung von Übernachtungskosten im Ausland bei Auswärtstätigkeiten und im Rahmen der doppelten Haushaltsführung auf maximal 2.000 Euro pro Monat zu begrenzen. Damit würde die derzeit geltende unbegrenzte Steuerfreiheit eingeschränkt.
Ob und in welchem Umfang die Bundesregierung diese Vorschläge aufnimmt, ist derzeit noch offen. Die abschließende Entscheidung hängt vom weiteren parlamentarischen Verfahren ab. Die Zustimmung des Bundesrates ist für den 19.12.2025 vorgesehen. Das Gesetz könnte somit zum 01.01.2026 in Kraft treten.
Elektronischer Datenabruf für private Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge ab 2026
Ab dem Jahr 2026 werden Beiträge zur privaten Krankenund Pflegepflichtversicherung nicht mehr wie bisher im Papierverfahren, sondern ausschließlich elektronisch über das ELStAM-System berücksichtigt. Grundlage dafür ist ein Datenaustausch zwischen den Versicherungsunternehmen, dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) und den Arbeitgebern. Ab dem 01.01.2026 sollen die Versicherer die von ihnen festgesetzten Beitragsbeträge der jeweiligen versicherten Person an das BZSt übermitteln. Dort werden diese Daten den elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen zugeordnet und den Arbeitgebern im Rahmen des ELStAM-Verfahrens zur Verfügung gestellt.
Die Finanzverwaltung hat im Schreiben vom 03.06.2025 klargestellt, wie dieser Datenaustausch ablaufen soll. Wichtig ist der Grundsatz, dass es sich immer um eine vorausschauende Meldung handelt. Es werden also nicht die tatsächlich geleisteten Zahlungen durch die Versicherungsnehmer übermittelt, sondern die vom Versicherungsunternehmen festgesetzten Beiträge. Grundlage hierfür ist § 39 Abs. 4a EStG. Wenn es zu Abweichungen kommt, zum Beispiel durch Kündigung des Vertrags, abweichende Zahlungen, Todesfall oder eine ungültige Identifikationsnummer, muss der gemeldete Datensatz entweder storniert oder durch eine berichtigte Neumeldung ersetzt werden. Jede Änderung wird dem jeweiligen Arbeitgeber über einen aktualisierten ELStAM-Datensatz mitgeteilt.
Im Rahmen des sogenannten Bestimmungsgrundsatzes ist geregelt, dass bei Vorauszahlungen die zugehörigen Beiträge immer dem Zeitraum zugeordnet werden, für den sie bestimmt sind. Wird also etwa eine Jahresvorauszahlung geleistet, muss diese gleichmäßig auf die einzelnen Monate verteilt werden. Versicherungsunternehmen haben sicherzustellen, dass die Datenübermittlung diesen Anforderungen entspricht. Für Arbeitgeber gilt, dass sie ausschließlich die vom BZSt bereitgestellten Daten berücksichtigen dürfen. Eine eigenständige Prüfung oder Bewertung der Beitragsbeträge ist nicht vorgesehen.
Zusätzlich ist zu beachten, dass das Sonderausgabenabzugsverfahren nach dem Abflussprinzip des § 11 Abs. 2 EStG weiterhin gilt. Steuerpflichtige können daher nach wie vor bis zum Dreifachen der Jahresbeiträge für ihre private Kranken- und Pflegeversicherung im Voraus zahlen und diese Beiträge in ihrer Einkommensteuererklärung absetzen. Auf diese Weise lässt sich gezielt Einfluss auf die steuerliche Berücksichtigung weiterer Versicherungsaufwendungen nehmen, die ansonsten keine oder nur geringe Steuerwirkung entfalten.
Im Gegensatz dazu werden Rückzahlungen von Beiträgen durch die Versicherungsunternehmen, etwa im Rahmen einer Beitragsrückerstattung, nicht im Rahmen des elektronischen Verfahrens berücksichtigt. Diese Beträge fließen in die individuelle Einkommensteuererklärung ein und sind dort zu erfassen.
Meldepflichtig sind alle Versicherungsunternehmen, die private Kranken- oder Pflegevollversicherungen anbieten und der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unterstehen. Unternehmen ohne Sitz oder Geschäftsleitung im Inland unterliegen nicht der Meldepflicht. Auch Versicherungsunternehmen, die lediglich Zusatzversicherungen wie Krankenhaustagegeld oder Krankentagegeld anbieten, sind nicht zur Meldung verpflichtet.
Die Meldepflicht besteht unabhängig vom beruflichen Status der versicherten Person. Beiträge müssen also auch für Selbstständige, Rentner oder Beschäftigte mit Nebenjobs gemeldet werden. Entscheidend ist, dass es sich um eine relevante Versicherung handelt. Die Meldung hat spätestens bis zum 20. November des Vorjahres zu erfolgen, frühestens jedoch ab dem 1. Januar des Vorjahres. Beginnt ein Versicherungsverhältnis im laufenden Kalenderjahr, ist die Meldung unverzüglich vorzunehmen. Auch Änderungen während des Jahres, etwa durch einen Wechsel des Tarifs, des Beihilfesatzes oder der mitversicherten Personen, müssen innerhalb von fünf Werktagen nach Bekanntwerden durch das Versicherungsunternehmen gemeldet werden.
Für die Datenübermittlung werden die Identifikationsnummer und das Geburtsdatum der versicherten Person benötigt. Liegt der Versicherung kein Identifikationsmerkmal vor, darf keine Meldung erfolgen. Ohne Meldung wiederum kann der Arbeitgeber die Beitragsdaten steuerlich nicht berücksichtigen. Um diesen Fall zu vermeiden, dürfen Versicherungsunternehmen die Identifikationsnummer beim BZSt abrufen.
Versicherte haben die Möglichkeit, der Übermittlung ihrer Daten zu widersprechen. Ein solcher Widerspruch kann in beliebiger Form erfolgen, etwa per Brief, E‑Mail oder über ein digitales Formular. Eine gesetzlich vorgeschriebene Form gibt es nicht. Der Widerspruch gilt jedoch immer nur für die Zukunft, nicht rückwirkend.
Bevor das BZSt die gemeldeten Beiträge an die Arbeitgeber weiterleitet, wird in der Regel geprüft, ob die betroffene Person aktuell in einem Beschäftigungsverhältnis steht. Liegen mehrere parallele Arbeitsverhältnisse vor, wird der Datensatz allen Arbeitgebern zur Verfügung gestellt. Die übermittelten Beträge sind verbindlich im Lohnsteuerabzugsverfahren anzuwenden.
Kommt es durch eine Korrekturmeldung zu einer rückwirkenden Änderung, die eine höhere Steuerlast auslöst, und kann der Arbeitgeber diese zusätzliche Steuer nicht mehr vom Arbeitnehmer einbehalten, muss er den Differenzbetrag dem zuständigen Betriebsstättenfinanzamt unverzüglich über eine Meldung nach § 41c EStG anzeigen.
Sollte es aufgrund technischer Probleme oder einer fehlenden Übermittlung nicht möglich sein, den elektronischen Datensatz zu nutzen, kann das Versicherungsunternehmen dem Arbeitnehmer eine Papierbescheinigung ausstellen. Diese kann dann dem Wohnsitzfinanzamt vorgelegt werden, welches daraufhin eine Bescheinigung ausstellt, die vom Arbeitgeber beim Lohnsteuerabzug verwendet werden darf.
Für die Jahre 2026 und 2027 sieht das BMF-Schreiben eine Übergangsregelung vor. In diesen beiden Jahren wird es nicht beanstandet, wenn der Arbeitgeber eine vom Versicherungsunternehmen ausgestellte Papierbescheinigung verwendet. Dennoch hat ein elektronischer Datensatz grundsätzlich Vorrang. Nur wenn dieser widerrufen wurde, darf auf die Papierform zurückgegriffen werden.
Markus Stier