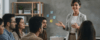Drei Stufen zur effektiven Datenschutzschulung : Nie wieder „Schon wieder?“
Es ist Montag, Sie starten Ihr Notebook. Der Kaffee steht bereits neben Ihnen, die Erholung vom Wochenende klingt noch nach. Etwas verschlafen öffnen Sie Ihr E Mail Postfach, um zu sehen, was heute ansteht.
Direkt springt Ihnen eine neue Nachricht ins Auge: „Termin: Datenschutz-Basisschulung“
Ein Gedanke schießt Ihnen sofort in den Kopf: Schon wieder?
Es ist nicht schwer, sich in diesem Szenario wiederzuerkennen. Schulungen – insbesondere Pflichtschulungen –begegnen uns regelmäßig im Arbeitsalltag. Beim ersten Durchlauf ist man neugierig auf den Inhalt oder die Art der Präsentation. Doch ab dem zweiten Mal schleicht sich Langeweile ein.
Es existieren viele verschiedene Methoden, um Inhalte zu vermitteln. Manche sind besser geeignet, andere weniger. Datenschutzschulungen verfolgen neben der Wissensvermittlung auch den Zweck, das Verhalten der Teilnehmer im Arbeitsalltag zu beeinflussen. Hält sich im Arbeitsalltag ein Beschäftigter nicht an Abläufe, führt das nicht selten auch zu einem Verstoß gegen Datenschutzrecht, für den das Unternehmen mit einem Bußgeld belegt werden kann oder – sofern ein Schaden entstanden ist – den dieses ersetzen muss.
Auch mit Blick auf die Rechenschaftspflicht nach Art. 5 Abs. 2 Datenschutzgrundverordnung (DS‑GVO), nach der Unternehmen nachweisen können müssen, dass sie die DS‑GVO einhalten, spielen Datenschutzschulungen eine wichtige Rolle. Sie belegen, dass Beschäftigte informiert wurden.
Die Herausforderung ist, einerseits so zu schulen, dass Beschäftigte das erforderliche Wissen erhalten und ihr Verhalten entsprechend ausrichten, aber auch einen Beitrag zur Rechenschaftspflicht zu leisten. Ressourcen sollen zudem gespart und wertvolle Arbeitszeit so effizient wie nur möglich eingesetzt werden.
Bekannte Schulungsmethoden
Auch bei Datenschutzschulungen kommen die bekannten Methoden zum Einsatz.
Am einfachsten und kostengünstigsten zu erstellen, ist der klassische foliengestützte Vortrag. Entsprechende Foliensätze lassen sich auch bei externen Anbietern einkaufen. Teilnehmer müssen sich bewusst anstrengen, um nicht nur zu lauschen, sondern das Gehörte auch zu verinnerlichen. Ohne Verinnerlichung erfolgt jedoch keine Übertragung auf das eigene Verhalten. Hinzu kommt, dass die Schulungsinhalte häufig generisch sind und von externen Dienstleistern stammen. Eine nachträgliche Anpassung an die unternehmensspezifischen Besonderheiten findet selten statt. Zwar werden Grundlagen vermittelt, jedoch fehlen die individuellen Prozesse, Dokumente oder Formulare, die im Alltag genutzt werden müssen. Ohne die unternehmensspezifischen Vorlagen, Abläufe und Muster ist der Wert für die Rechenschaftspflicht begrenzt.
Um Inhalte effizient und flexibel zu vermitteln, setzen viele Unternehmen auf autonome Onlineschulungen. Dank interaktiver Formate werden die Teilnehmenden aktiv einbezogen und ziehen bereits erste Parallelen zu ihrem Arbeitsalltag. Die Produktion solcher Schulungen ist zwar aufwendiger und in der Anschaffung teurer, verspricht aber einen höheren Lerneffekt. Allerdings bleibt ein zentrales Problem bestehen: Die Inhalte sind oft weiterhin zu allgemein gehalten, und die Gefahr des bloßen ‚Durchklickens‘ ist groß. Ohne gezielte Anpassung an das Unternehmen werden spezifische Abläufe oder Dokumente kaum berücksichtigt. Dadurch fehlt der direkte Bezug zu den individuellen Arbeitsprozessen. Eine nachhaltige Wissensvermittlung und die gewünschte Verhaltensanpassung sind somit nicht garantiert – oder zumindest nicht in dem Maße, wie es mit einer solchen Schulung eigentlich erreicht werden sollte.
Eine Mischform, bei der Teilnehmende bequem von zu Hause aus einer LiveSession mit Dozenten folgen, gehört mittlerweile ebenfalls zum Standard. Von einer klassischen Präsenzschulung unterscheidet sich dieses Format nur wenig und ist sowohl beim organisatorischen Aufwand als auch bei den Kosten überschaubar. Die Schwächen bleiben jedoch bestehen: Die Inhalte sind häufig zu allgemein, unternehmensspezifische Aspekte werden nur am Rande behandelt oder ganz ausgespart, und die Teilnehmenden müssen sich sehr anstrengen, das Gelernte wirklich zu verinnerlichen. Zusätzlich ist die Ablenkungsgefahr hoch: Wenn Kamera und Ton ausgeschaltet sind, bleibt unklar, ob die Inhalte tatsächlich verfolgt werden – oder ob nebenbei längst an anderen Aufgaben gearbeitet wird. Der erhoffte Lernerfolg und die angestrebte Verhaltensanpassung sind daher nur eingeschränkt zu erwarten.
Keine dieser Methoden stellt für sich genommen eine zufriedenstellende Lösung für die eingangs beschriebenen Anforderungen an Datenschutzschulungen dar. Die Autoren regen deshalb an, verschiedene Methoden zu kombinieren. Zielstellung ist
- nur Teilnehmer mit Wissenslücken zu schulen,
- das Verinnerlichen zu unterstützen,
- eine flexible Zeiteinteilung zu ermöglichen und
- den Lernerfolg zu dokumentieren.
Drei-Stufen-Modell
Im Rahmen der Schulungseinladung werden die einzelnen Stufen vorgestellt. Bereits in der ersten Stufe können Teilnehmende die Schulung erfolgreich absolvieren – vorausgesetzt, ihr Wissen ist ausreichend vorhanden und bereits im Arbeitsalltag verankert. Das verhindert „Durchklicken“und vermeidet überflüssige Schulungen.
Wissensabfrage oder Onlineschulung
Im ersten Schritt können die Teilnehmenden wählen: Entweder absolvieren sie eine reine Wissensabfrage oder eine Onlineschulung mit anschließender Wissensabfrage.
Die Wissensabfrage erfolgt in Form eines Multiple-Choice-Tests. Wird eine bestimmte Punktzahl erreicht, gilt die Schulung als bestanden. Ziel ist es, den Teilnehmenden die Möglichkeit zu geben, ihr Wissen zu überprüfen und zu bestätigen. Ist es ausreichend und im Alltag verankert, können sie die Schulung direkt „abkürzen“
Scheitern sie an der Wissensabfrage, zeigt das nicht nur, dass das Wissen noch Lücken aufweist, sondern auch, wo diese bestehen. Diese Selbstkontrolle regt zur Reflexion und zum kritischen Hinterfragen an.
Zudem sollte hier überprüft werden, ob die Teilnehmenden mit den unternehmensspezifischen Prozessen, Vorlagen und Muster vertraut sind:
Wer sich direkt für die Onlineschulung entscheidet, überspringt die erste Stufe und beginnt sofort mit der zweiten.
Onlineschulung
Eine nicht bestandene Wissensabfrage führt automatisch zur Onlineschulung mit abschließender Wissensabfrage. Hier werden die Inhalte mit interaktiven Elementen vermittelt. Teilnehmende, die die Wissensabfrage in der ersten Stufe nicht bestanden hatten, können das Feedback aus der Wissensabfrage nutzen, um gezielt ihre Wissenslücken zu schließen.
Die Schulung läuft vollständig autonom ab. Die Teilnehmenden entscheiden selbst, wann, wie schnell und auf welchem Gerät sie lernen – ob im Büro, auf der Couch oder unterwegs in der Bahn. Diese Flexibilität erleichtert den Zugang und erhöht die Akzeptanz.
Interaktive Elemente binden die Lernenden aktiv ein und stellen sicher, dass die Inhalte wirklich bearbeitet werden. Die anschließende Wissensabfrage dient als kurze Reflexion und überprüft, ob die Themen tatsächlich verinnerlicht wurden. Beide Mechanismen erschweren ein einfaches Durchklicken. Zusätzliche Maßnahmen wie zufällige Fragenreihenfolgen oder Antwortreihenfolgen sind möglich. Wird die Wissensabfrage nicht bestanden, führt der Weg in die dritte Stufe – die Präsenzschulung.
Präsenzschulung
In der letzten Stufe werden Teilnehmende aufgefangen, deren Wissenslücken so groß sind, dass persönliche Unterstützung erforderlich ist. Hier können Expertinnen und Experten individuell auf Fragen eingehen und durch Praxisbeispiele ein tieferes Verständnis fördern.
Eine erneute Wissensabfrage ist nicht vorgesehen – in dieser Stufe ist das Ziel, das Wissen vollständig aufzubauen und nachhaltig in den Arbeitsalltag zu integrieren.
Fazit
Unabhängig von der Methode bleiben Datenschutzschulungen ein herausforderndes Thema: Allgemeines, aber auch unternehmensspezifisches Wissen ist zu vermitteln. Dabei soll erreicht werden, dass Beschäftigte ihr Verhalten an den gesetzlichen Anforderungen ausrichten. Der Lernerfolg sollte zudem nachweisbar sein.
Das gelingt deutlich besser, wenn Teilnehmende nicht nur passiv konsumieren, sondern aktiv eingebunden werden – und selbst entscheiden dürfen, wie sie lernen.
Das Drei-Stufen-Modell eröffnet genau diese Wahlmöglichkeiten. Wer über ausreichend Wissen verfügt, kann direkt einsteigen und Zeit sparen. Wer Unterstützung braucht, erhält sie in abgestuften Formaten – von der Onlineschulung bis zur Präsenzveranstaltung.
Für Unternehmen bedeutet das ebenfalls Vorteile: Ressourcen werden geschont, weil Mitarbeitende mit ausreichendem Vorwissen schneller wieder in den Arbeitsalltag zurückkehren. So bietet das Modell nicht nur bei Teilnehmenden mehr Akzeptanz, sondern auch den Veranstaltenden einen vielversprechenden Ansatz für effektive Schulungen.
Nina Müller und Dr. Niels Lepperhoff, Xamit Bewertungsgesellschaft mbH