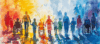Inklusion zwischen Zahlen, Zwängen und Zynismus : Armseliger Ablasshandel?
Wo steht heute die Arbeitswelt, wenn es darum geht, eine Unternehmenskultur zu schaffen, in der behinderte Mitarbeitende sich überhaupt als gleichwertiger Teil des Unternehmens fühlen können? Was tun wir (wirklich) dafür, dass behinderte Menschen das Gefühl haben, sich über ihre Bedürfnisse oder sogar Sorgen äußern zu können, ohne sich vor Stigmatisierung oder gar Ausgrenzung, wenn nicht sogar (vorsorglicher) Ausmusterung zu fürchten? Wo bleiben Wirksamkeit und Würde? Und wo machen wir uns ganz schön was vor, wenn wir glauben, vermeintlich alles zu tun oder zumindest „ausreichend“ etwas zu tun?
Kann es sich Ihr Kollege oder Mitarbeiter wirklich leisten, anders zu sein?
Lasst Zahlen sprechen?
Seit Januar 2024 gilt das Gesetz zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarkts. Das bedeutet, Unternehmen mit mindestens 60 Arbeitsplätzen, die keinen Menschen mit Schwerbehinderung beschäftigen, zahlen seither eine fast verdoppelte Ausgleichsabgabe von 720 Euro im Monat und pro unbesetztem „Pflichtarbeitsplatz“. Allein dem letzten Begriff ist schon ein bitterer Geschmack beigemischt.
Echtes Armutszeugnis?
Natürlich – es gibt sie! Aktion Mensch verweist regelmäßig auf zahlreiche Beispiele, die beweisen, dass Unternehmen auf freiwilliger Basis und durchaus erfolgreich einen Beitrag zur Inklusion leisten. Das ist schön zu sehen, aber leider sprechen die Zahlen sonst für sich. Denn Ende 2024 wurde das 12. Inklusionsbarometer Arbeit von Aktion Mensch veröffentlicht – leider ohne das Ergebnis einer positiven Entwicklung. Die Arbeitslosenquote für Menschen mit Schwerbehinderung lag im Jahr 2023 bei 11 Prozent, während die allgemeine Quote in Deutschland bei 5,7 Prozent lag. Im Jahr davor war es kaum besser. Wir können diesem Thema erst ernsthaft und ehrlich begegnen, wenn wir uns eingestanden haben, dass in Wirklichkeit die größten Hindernisse oft nicht körperlicher Natur sind, sondern in den Strukturen und Vorurteilen unserer Gesellschaft liegen. Behinderte Menschen werden erst dann wirklich zum Teil unserer Arbeitswelt, wenn es um weitaus mehr geht als darum, „ein paar Tabus zu brechen“.
Genauer hinsehen?
Mehr Sichtbarkeit könnte da ein Ansatz ein, um mit der Zeit mehr Akzeptanz zu erzielen – vor allem fehlt es aber (weiterhin) zu sehr an der Vorstellungskraft, wie behinderte Menschen die Arbeitswelt bereichern, und das liege vor allem in der Verantwortung der Arbeitgeber, so VdK-Präsidentin Verena Bentele. Insgesamt betont der Sozialverband VdK den weiterhin großen Nachholbedarf, wenn es um die Integration von Menschen mit Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt geht. Als Hauptursache werden hier immer noch die Vorurteile genannt.
Laut gelogen?
Auch ist es weiterhin so, dass Ende 2024 etwa ca. 40 Prozent der Unternehmen die vorgeschriebene Beschäftigungsquote von 5 Prozent Mitarbeitenden mit Behinderung erfüllt haben. Von einer „Trendwende“ sind wir gefühlt Lichtjahre entfernt, da helfen auch schicke und bunte DiversityKampagnen herzlich wenig. Die allseits vielbeworbene Offenheit und Vielfalt bleiben weiterhin oft von außen aufgesetzte HR-Marketing-Mitteilungen, wenn man die Umsetzungsstrategien und die Nachhaltigkeitsmaßnahmen auf Herz und Nieren prüft. Gelebte Inklusion heißt zum Beispiel keinesfalls, dass ein „Vorzeigerollstuhlfahrer“ die Website oder einen Flyer ziert, als gebe es etwas Außerordentliches zur Schau zu stellen. Es ist noch ein weiter Weg, der deutlich über Akzeptanz und die Schaffung von Bedingungen hinausgehen müsste – in einer perfekten inklusiven Welt würden wir von Selbstverständlichkeit sprechen können.
Keine Ahnung?
Viele Unternehmen arbeiten vielleicht bereits inklusiv – ohne es überhaupt zu wissen. Genau deshalb gilt es hier, weiter zu hinterfragen: Es gibt vermutlich bereits deutlich mehr Beschäftigte mit Schwerbehinderungen in den eigenen Reihen, von denen die Verantwortlichen in den Unternehmen keine Ahnung haben. Die Motive, sich aus Selbstschutz lieber bedeckt zu halten bzw. „unsichtbar“ zu machen, bringt umso deutlicher zutage, wie sehr das Thema in unserer Gesellschaft und der Arbeitswelt die Angst vor Benachteiligungen mit sich bringt und mit Scham belegt ist. Zudem könnte zusätzlich die Furcht dahinterstecken, ein Mensch, Kollege und Mitarbeiter zweiter Klasse oder Wahl zu sein. Und gerade das zeigt symptomatisch, dass es nicht nur eine Frage der Unternehmenskultur ist, sondern immer noch zu tiefgreifend im Denken vieler verwurzelt ist. Umso mehr ist von Unternehmensseite zu tun, um ein Umdenken nicht nur zu fördern, sondern eine echte Inklusionskultur zu etablieren.
Falsch gefeiert?
Feiern und genauso Betriebsausflüge sollten sich trotz Rücksicht auf verschiedene Bedürfnisse nicht anfühlen wie eine „Zwei-Klassen-Veranstaltung“, frei nach dem Motto: „Packen wir sie einfach zu den Rentnern, die ja auch nicht so können.“ Selbst, wenn es vielleicht nicht so gedacht oder gemeint ist, man sollte sich schon Gedanken machen, wie das Ganze aussieht bzw. sich anfühlen könnte. Kleine aufmerksame Extras kann man schon im Vorfeld anbieten, damit die behinderten Mitarbeitenden sehen, dass für sie mitgeplant und -gedacht wird und sie sich nicht gezwungen fühlen, nicht teilzunehmen. Möglich sind Angebote wie bezahlte Taxifahrten, welche den Aspekt der Unabhängigkeit von anderen berücksichtigen.
Inklusion = all inclusive?
Gut gemeint ist aber nicht immer gut gemacht: So sollen Firmenfeiern vor allem verbinden und keinesfalls ausschließen. Das bezieht sich dann längst nicht nur auf die geplanten Aktivitäten, sondern schon auf Punkte wie Erreichbarkeit oder Zugänge. Die Planungen bewegen sich meist im Großen und Ganzen im Rahmen dessen, was für „die meisten“ machbar ist und nicht für (ausnahmslos) alle. Einer der Gründe ist, dass wir die Vorstellung bereits manifestiert haben, was für alle gut sein muss. Und dann heißt es auch nicht, dass man lieblose Alternativen schafft, für die, die das „dann ja leider nicht können“. So wäre es ein Ansatz, anonymisierte Rückmeldemöglichkeiten einzubinden oder anonyme Umfragen bei Mitarbeitenden zu starten oder vielleicht auch mal direkt zu fragen, was es denn braucht. Letzteres setzt allerdings voraus, dass man schon eine offene und vertrauensvolle Kommunikationsbasis geschaffen hat.
Still verschwunden?
Nicht bei jeder Betriebsgröße und -zusammensetzung ist es möglich, Kritikpunkte oder Bedürfnisse mitzuteilen, ohne sich dadurch direkt zu identifizieren. Ebenso kann es sein, dass Mitarbeitende es schon durch lebenslange Erfahrungen gewohnt sind – weil sie unsere Tendenz zur Exklusion kennen –, sich selbst zu entschuldigen, und Vermeidungsstrategien entwickelt haben. Daher sind nicht nur Fingerspitzen- und Feingefühl gefragt. Sich hineinfühlen, dürfte ebenso schwierig sein, wenn man selbst in keiner vergleichbaren Lebens- oder Leidenssituation ist. Hinzu kommt, dass Behinderungen sich nicht nur völlig unterschiedlich auswirken, die Betroffenen gehen unterschiedlich damit um – es ist also größte Vorsicht geboten, „zu vergleichen“. Wenn man schon daran denkt, etwas zu verbessern, dann sollte es sich nicht immer wie ein Kompromiss oder eine „praktische Lösung“ anfühlen oder wie ein „mühevolles Extra“, denn das macht keinen Spaß. Das Angebot sollte immer so selbstverständlich sein wie für alle anderen auch – denn dann passt es und wird sicher gern angenommen.
Offen gesprochen?
Wie offene Dialoge geführt werden können, damit Inklusion im Betrieb stattfindet und mit dem richtigen Mindset gelebt werden kann, macht eine entsprechende Sensibilisierung als Grundlage notwendig. Das erfordert natürlich entsprechende Schulungen oder Workshops – und das nicht nur für Führungskräfte. Dort sollte vermittelt werden, wie man echtes Verständnis aufbringt und Vorurteile abbaut. Dies kann bedeuten, dass mehr über bestimmte Krankheitsbilder bekannt wird, genauso könnte aber ein Kommunikationstraining helfen. Immens wichtig ist aber, dass behinderte Menschen nicht mit ihrem Leid in den Mittelpunkt gestellt werden wollen, sondern dass es geht darum, wie sie damit leben und arbeiten. Nadine Schönwald ist Head of Sales Support bei der Adecco Group und Fachkraft für Diversity Management. Sie warnt vor den fatalen Folgen von sogenannten „Mikroaggressionen“. Hier geht es um das Auslösen von vermeintlich kleinen Stichen, die sich mit der Zeit summieren. Das meint diesen Mix aus Aussagen, Blicken oder Gesten, die irgendwie „nett gemeint“, unter Umständen (mehr oder weniger) unterbewusst ausgeübt werden und meist auf Vorurteilen, die es dringend abzubauen gilt, basieren.
Achtsamkeit im Arbeitsalltag?
Viele Sprüche, die gut gemeint sein sollen, resultieren vielleicht aus Gedankenlosigkeit oder aus einer Art Hilflosigkeit. Nadine Schönwald verweist aber auf häufig beiläufige Bemerkungen oder Verhaltensweisen, die diskriminierend wirken, ohne dass diese unmittelbar als Angriff erkennbar sind. Dabei geht nicht um die größeren Beleidigungen an sich, sondern um diese kleinen wiederholten Signale wie: „Du bist anders. Du gehörst nicht ganz dazu. Du bist nicht voll leistungsfähig.“ Vermeintliche Freundlichkeiten, die trotzdem verletzen – davon sind behinderte Menschen besonders betroffen. Solche Mikroaggressionen verpacken vermeintliche Anerkennung in eine indirekte Abstufungskommunikation. Das sind Sätze wie: „Das merkt man dir ja trotz allem nicht an“, „Wahnsinn, wie du das überhaupt alles schafft“ oder „Das muss man in deiner Situation erstmal leisten können“. Weitere Merkmale sind bewundernde Überhöhungen oder, gerade andersherum, der immer wieder auftretende Versuch, auf eine falsche Art zu schonen. Das führt nicht nur dazu, dass sich der behinderte Mensch deplatziert, in eine eingeschränkte Ecke geschoben fühlt, sondern, noch viel schlimmer, sogar entmündigt und aussortiert. Sprache und Handlungen müssen reflektiert werden, damit behinderte Mensch nicht stets den (Leidens-)Druck verspüren, etwas zusätzlich ausgleichen, erklären oder gar verstecken zu müssen – denn das macht alles noch schlimmer.
Bäm im BEM?
Brauchen wir zunächst auch andersherum Extreme, um uns dann im gesunden Mittelfeld einzupendeln, was „normal“ ist? Keine Behinderung sollte zumindest mal irgendwann so etwas wie peinlich sein. Da muss sich gesellschaftlich definitiv noch sehr viel bewegen. Andersherum, wo ist kommunikativ gesehen die Grenze? Diagnosen haben zu wollen, hat etwas sehr Menschliches an sich: Etwas Unbekanntes bekommt „endlich“ einen Namen. Das erleichtert im Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) vielleicht zunächst eine erste Einordnung und gibt eine gewisse Orientierung. Andererseits will niemand selbst in eine Schublade gesteckt werden. Oft beginnen die BEMGespräche schon mit der Frage: „Und was hat jetzt diese Person eigentlich?“ Viel wichtiger ist, die Fragen zu klären, was gerade geht, was künftig möglich gemacht werden kann, und am besten noch, was darüber hinaus sogar auch noch Freude machen könnte.
Überall zweierlei „Raum“?
Schaut man sich an, wie sich die Themen im Netz entwickeln, so kann man dort wesentlich mehr „Outings“ wahrnehmen, wo Menschen ihre Krankheit ganz klar benennen. Woher kommt so ein krasser Unterschied? Natürlich kann es genauso an den Vorteilen der Anonymität im Internet liegen wie anders herum beim Verschweigen im echten Alltag durch die Furcht der Diskriminierung im Job. Was im Büro lieber noch als „Problem“ verborgen bleibt, erhält auf Kanälen wie TikTok eine neue Aufmerksamkeit. Entstehen nun endlich Räume, wo „anders sein“ gefeiert wird, oder finden sich hier nur durch Algorithmen neue Communitys mit ähnlichen Interessen oder Erfahrungen. Die Form der freien Kommunikation und der Eindruck von Interesse und Resonanz ermutigen behinderte Menschen, offener zu sprechen. Doch auch hier „läuft man Gefahr“, einfach wieder „nur“ Teil einer heterogenen Gruppe zu bleiben, wo man einfacher verstanden wird und im besten Fall als gleichwertig akzeptiert wird und hoffentlich durch das gefasste Vertrauen nicht angreifbar wird, wie man das von draußen kennt. Zumindest entsteht „neuer“ Raum für Austausch und Diskussionen.
Jeder schön in seiner „Bubble“?
Und diese „Bubble“ muss vor allem nicht nur größer werden, sondern im Grund eines, wie Inklusionsaktivist und Publizist Raul Krauthausen treffend zeigt – mit dem Beispiel der Barrierefreiheit: Wenn es um dieses Thema geht, so räumen viele Menschen zwar ein, dass dies ein wichtiger Punkt sei – aber es betrifft sie selbst (gerade) ja nicht. Das sei ein sehr großer Denkfehler, so Krauthausen: „Barrierefreiheit ist keine Sonderausstattung für Einzelne – sie ist die Grundlage dafür, dass alle Menschen gleichberechtigt leben, lernen, arbeiten und sich bewegen können. Barrierefreiheit darf nicht erst dann relevant werden, wenn man sie selbst braucht. Solidarität zeigt sich nicht im eigenen Bedarf – sondern im gemeinsamen Handeln.“
Fazit
Solange wir nicht dazu übergehen, aus Inklusion eine echte Haltung zu machen, sondern sie behandeln wie eine Einräumung von gewährten Sonderrechten und die Schaffung von „gnädigen Extrabedingungen“, sollten wir uns im Grunde weder Gemeinschaft noch Gesellschaft nennen – dies gilt ebenso und auf besondere Weise für die Arbeitswelt. Wenn wir nicht alle mitdenken, dann bleiben wir ein elitärer und privilegierter Haufen, der für sich (derzeit) einfach nur von deutlich mehr Glück durch Teilhabe sprechen kann – während er andere weiter ausschließt.
Indem wir nicht bereit sind, kommunikative, bauliche und digitale Hürden wirklich abzubauen, machen wir uns zum Thema Inklusion weiter ganz schön was vor. An dieser nicht konsequenten Einstellung und im Grunde unaufrichtigen und leider ganz und gar gängigen Handhabung werden auch ein paar schöne Einzelaktionen und schicke Publicity-Kampagnen nichts ändern. Und sie werden uns längst nicht von irgendetwas „reinwaschen“, was wir vorgeben „gut zu machen“. Da müssen wir längst deutlich ehrlicher zu uns sein – und das fängt mit jedem Einzelnen von uns an, damit es wirksam ans große Ganze gehen kann.
Dr. Silvija Franjic, Jobcoach und Fachredakteurin