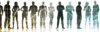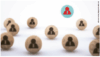Interview : „Nicht alles als ‚Human Capital‘ bezeichnen“
Vom Unwort des Jahres zur angesagten Managementmethodik: Der Begriff „Human Capital“ und das damit verbundene Human Capital Management haben eine steile Karriere hinter sich und werden gelegentlich synonym zu Human Resources Management verwendet. Auch in der Wissenschaft gibt es unterschiedliche Auffassungen zu der Frage, was Human Capital Management eigentlich ist. Prof. Dr. Sabine Raeder, Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Oslo und Privatdozentin an der ETH Zürich, findet aber ganz unabhängig davon, dass Unternehmen und Personalabteilungen von dem Konzept profitieren können.
Frau Prof. Dr. Raeder, was ist Human Capital Management und inwiefern unterscheidet es sich vom Human Resources Management?
Das Konzept des Human Capital (HC), lässt sich bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen, im 18. referiert auch Adam Smith darauf. Eine neue, moderne Version stammt aus den 1960er Jahren und geht auf Gary Becker zurück. Dieser US-amerikanische Ökonom verfasste 1964 ein Werk mit dem Titel „Human Capital“, das zum Standardwerk wurde. Er definiert Humankapital darin als die Summe des Wissens, der Fähigkeiten und der Gesundheit eines Menschen im Arbeitsprozess. Je höher dieses Humankapital sei, so seine These, desto mehr könnten die Betreffenden verdienen, einen ökonomischen Nutzen daraus ziehen.
Das unterscheidet sich etwas von der heutigen Perspektive, die in erster Linie das Unternehmen als wirtschaftlichen Nutznießer des Humankapitals sieht, oder?
Ja, das ist richtig. Es ist in diesem Zusammenhang interessant, dass noch im Jahr 2004 der Begriff „Humankapital“ zum Unwort des Jahres gewählt wurde, damals mit der Begründung, dass er den Begriff Menschen zu einer „nur noch ökonomisch interessanten Größe“ degradiere. Auch die Gesundheit eines Mitarbeitenden ist heute aus der Humankapitaldefinition verschwunden, insofern hat sich hier einiges verändert.
Human Capital Management im Sinne Gary Beckers eint, dass es gesellschaftlich relevant ist, in das Humankapital der Menschen zu investieren, weil sie anschließend bessere Jobs ausführen und mehr Geld verdienen können. Investitionen können in Form von Schulbildung, Universitätsstudiengängen, Trainings oder anderen Maßnahmen erfolgen. Das ist in dieser Weise in den Folgejahrzehnten nicht immer so verstanden worden.
Lassen Sie uns ins Heute schauen – welchen wesentlichen Ansatz sehen Sie da?
Im US-amerikanischen Verständnis ist HC heute eine Ressource in einem ressourcenbasierten Blick auf das Unternehmen. Organisationstheoretisch ließe sich das so einordnen, dass die Firmen versuchen, Ressourcen aufzubauen, um einen Wettbewerbsvorteil zu gewinnen – und zwar mit einzigartigen Ressourcen, da das Ganze sehr auf Innovation fokussiert ist. Diese Sichtweise ähnelt der von Gary Becker, allerdings eben bereinigt um die Gesundheit der Mitarbeitenden.
Im zeitgemäßen Verständnis lässt sich zudem weiter unterscheiden: Zum einen ist die Frage unter Organisationsgesichtspunkten, wie das individuelle Human Capital der einzelnen Mitarbeitenden so kombiniert werden kann, dass ein wissens- und fähigkeitsbasierter Vorteil gegenüber anderen Unternehmen entsteht. Dabei geht es immer nur um das, was gerade gefragt und für die jeweilige Aufgabe relevant ist. Aus Sicht des jeweiligen Mitarbeiters lässt sich eher fragen, wie firmenspezifisch, wie leicht übertragbar und wie nachgefragt am Arbeitsmarkt die Komponenten seines HC sind.
Was können HR-Abteilungen konkret damit anfangen?
Sie müssen sich fragen, wie sie das Human Capital verbessern können. Das betrifft sowohl die bestehenden als auch potenzielle neue Mitarbeitende. Bei den bestehenden geht es darum, Wege zu finden, wie HC bottom-up entstehen kann, etwa durch ein Voneinander-Lernen. Beim Recruiting geht es dann darum, die Lücken meines gesammelten Human Capital in der Organisation mit den passenden neuen Mitarbeitenden zu schließen.
Das klingt alles gar nicht so viel anders als Human Resources Management im Allgemeinen. Doch HCM ist etwas anderes, oder?
Meiner Meinung nach schon, ich betrachte es als einen kleineren Teil des gesamten Human Resources Management, das noch deutlich mehr umfasst. Es gibt aber auch Kollegen, die die Begriffe synonym setzen. Persönlich würde ich davon abraten, alles als Human Capital zu bezeichnen, was die Personalarbeit angeht, das könnte dann – Stichwort Unwort – doch etwas abwertend klingen. Denn Mitarbeitende sind ja tatsächlich mehr als nur reines Kapital oder eine Ressource.
Gibt es einzelne Maßnahmen, die Sie dem HCM zuordnen würden und die Vorteile für Unternehmen bringen?
Seinen konkreten Niederschlag kann HCM in der Organisation zum Beispiel bei der Auswahl, der Recruiting, der Weiterbildung oder auch der Arbeitsplatzgestaltung bringen. Sinnvolle Fragen sind in diesem Zusammenhang: Wie können Mitarbeitende innerhalb ihres Arbeitskontextes lernen? Wie wird der Wissensaustausch befördert? Im Rahmen der Mitarbeitergespräche kann es ratsam sein, einen Entwicklungsplan für den einzelnen Mitarbeiter aufzustellen, in dem bestimmte Ziele vereinbart werden. All das ist Human Capital Management.
Betrifft Human Capital Management mehr den einzelnen Mitarbeitenden oder nicht auch die Interaktion innerhalb der Teams und der Organisation?
Sie haben Recht, wenn es um die Kombination von Wissen innerhalb eines Teams geht, durch das neues Humankapital entsteht. Was explizit nicht zum Human-Capital-Konzept gehört, ist das soziale Kapital. Dieses umfasst die Vernetzung der Mitarbeitenden innerhalb und außerhalb der Organisation. Im Zentrum steht zwar wieder der Wissensaustausch, aber auch zum Beispiel die Öffnung für etwaige Kooperationen. Es kann sich für Unternehmen durchaus lohnen, ihre Mitarbeitenden anzuregen, sich zu vernetzen – IBM hat das zum Beispiel in besonderer Weise getan.
Lässt sich der Erfolg solcher Maßnahmen überhaupt messen?
In aller Regel nicht, gerade beim Sozialkapital kann es ja auch längere Zeit dauern, ehe sich Effekte einstellen, und diese lassen sich vermutlich oftmals nicht auf konkrete Aktivitäten zurückführen. Insofern entzieht sich der HC-Ansatz der Messbarkeit. Das widerspricht etwas dem Fokus großer Strategieberatungen, die natürlich auf den finanziellen Gegenwert ihrer Beratung achten und eng entlang der Frage arbeiten, wie lohnend der Personaleinsatz insgesamt ist.
Lassen Sie uns noch einmal auf die Verbindung von HRM und HCM schauen – wie machen Sie die beiden Konzepte greifbar? Gibt es Dinge, die sich in der konkreten Personalarbeit im Unternehmen übertragen oder kombinieren lassen?
Prof. Dr. Sabine Raeder hat den Lehrstuhl für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Oslo inne. Daneben arbeitet die Schweizerin an der ETH in Zürich als Privatdozentin.
In der HRM-Forschung gibt es ein Modell, das Ability-, Motivation- und Opportunity-fördernde Maßnahmen unterscheidet. Wenn wir auf den Ability-Strang schauen, dann deckt sich dieser meiner Meinung nach weitgehend mit dem HCM-Konzept. Insofern ist da vielleicht gar nicht so viel Neues oder anderes. Diese Tatsache ist aber an sich gar nichts Ungewöhnliches, denn im HRM gibt es eine ganze Reihe verschiedener Theoriegebäude, die sich überschneiden.
Vielleicht taucht das Schlagwort „HCM“ derzeit häufiger auf, weil es verschiedentlich Lösungen gibt, die sich eher darunter subsumieren lassen. Letztlich geht es aber in der Personalarbeit immer um sehr viel mehr, etwa um die Frage, wie sich Teamarbeit etablieren lässt, wie die Karriereentwicklung aussehen kann und vieles andere. Unternehmen gehen mit den Ansätzen zu Recht opportunistischer um: Hilft es mir oder nicht? Wenn schon alles abgedeckt ist, brauche ich mich nicht um einen neuen Ansatz zu kümmern.
Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Alexandra Buba, M. A., Wirtschaftsredakteurin