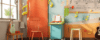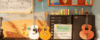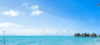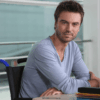Im Blick: Arbeitsrecht
Freie Mitarbeit, Urlaubsabgeltung, DSGVO-Auskunftsanspruch und Kündigungsschutz für Schwerbehinderte – alle aktuellen Praxisurteile 2025 im Überblick.
Keine persönliche Abhängigkeit: Musikschullehrerin ist keine Arbeitnehmerin
Arbeitsgericht Berlin, Entscheidung vom 15.07.2025 – Az. 22 Ca 10650/24
Es gibt Neues aus dem Bereich Scheinselbständigkeit. Das Arbeitsgericht Berlin hat entschieden, dass die Beschäftigung einer Musikschullehrerin mangels Weisungsgebundenheit und persönlicher Abhängigkeit nicht als Arbeitsverhältnis zu qualifizieren ist. Die Entscheidung stärkt die Differenzierung zwischen freier Mitarbeit und abhängiger Beschäftigung im Kulturbereich – und grenzt sich bewusst von der viel diskutierten Herrenberg-Entscheidung des Bundessozialgerichts (BSG) ab.
Einordnung des Urteils
Mit Urteil vom 15.07.2025 (Az. 22 Ca 10650/24) hat das Arbeitsgericht Berlin die Klage einer Musikschullehrerin abgewiesen, die die Feststellung eines Arbeitsverhältnisses begehrte. Die Entscheidung ist von besonderer Bedeutung für öffentliche und private Musikschulen, die mit freien Mitarbeitenden arbeiten, und sie setzt ein klares Zeichen gegen eine pauschale Ausweitung des Arbeitnehmerbegriffs im Kulturbereich.
Das Gericht stellt klar: Eine Tätigkeit als Musikschullehrerin kann – trotz langjähriger Zusammenarbeit und regelmäßiger Unterrichtstätigkeit – als freie Mitarbeit ausgestaltet sein, wenn keine persönliche Abhängigkeit und Weisungsgebundenheit vorliegt.
Auf den ersten Blick überrascht diese Entscheidung, hatte man sich doch zwischenzeitlich seit der Herrenberg-Entscheidung gemerkt, dass (Musik-)Lehrer eigentlich immer eingegliedert sind. Das BSG hatte damals wegen einer stärkeren Gewichtung des Kriteriums der Eingliederung in die Betriebsabläufe eine abhängige Beschäftigung festgestellt, was erhebliche Kostenfolgen für Arbeitgeber:innen hat. Der Teufel steckt also bekanntlich im Detail und man muss genau hinschauen.
Der Sachverhalt
Die Klägerin war seit 1999 als freie Mitarbeiterin in einer Berliner Musikschule tätig, die vom Land Berlin betrieben wird. Ihre Beschäftigung beruhte auf mehreren befristeten Rahmenverträgen, zuletzt aus dem Jahr 2022. Darin war ausdrücklich geregelt, dass sie außerhalb eines Arbeitsverhältnisses tätig ist, Einzelaufträge erhält und Honorare für geleisteten Unterricht erhält. Zudem war vereinbart, dass sie frei über Ort, Zeit und Inhalt des Unterrichts entscheidet.
Im Juni 2024 stellte die Deutsche Rentenversicherung mit einem noch nicht bestandskräftigen Bescheid fest, dass die Klägerin sozialversicherungsrechtlich als abhängig Beschäftigte zu qualifizieren sei. Kurz darauf kündigte das Land Berlin den Rahmenvertrag zum 30.09.2024.
Die Klägerin erhob Klage vor dem Arbeitsgericht Berlin. Sie argumentierte, dass sie tatsächlich wie eine Arbeitnehmerin tätig gewesen sei – weisungsgebunden, in die Organisation der Musikschule eingegliedert und nicht frei in der Gestaltung ihrer Tätigkeit. Die Kündigung des Rahmenvertrags sei daher unwirksam, da ein Arbeitsverhältnis bestanden habe.
Die Entscheidung
Das Arbeitsgericht Berlin wies die Klage ab. Es stellte fest, dass kein Arbeitsverhältnis im Sinne von § 611a Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) vorliegt. Maßgeblich sei eine Gesamtbetrachtung der tatsächlichen Umstände, insbesondere:
- Fehlende Weisungsgebundenheit: Die Klägerin konnte frei entscheiden, wann und wo sie unterrichtet. Der Unterricht konnte auch außerhalb der Musikschule stattfinden.
- Keine persönliche Abhängigkeit: Sie war nicht verpflichtet, bestimmte Schüler zu unterrichten, sondern konnte Unterrichtsangebote annehmen oder ablehnen.
- Keine Eingliederung in die Arbeitsorganisation: Anders als fest angestellte Lehrkräfte war sie nicht in organisatorische Abläufe eingebunden, etwa in Bezug auf Stundenpläne, Vertretungen oder interne Abstimmungen.
- Vertragliche Klarheit: Die Rahmenverträge sahen ausdrücklich eine freie Mitarbeit vor, mit Einzelaufträgen und Honoraren statt Gehalt.
Auch die tatsächliche Durchführung der Zusammenarbeit bestätigte laut Gericht die freie Mitarbeit. Es habe keine Anhaltspunkte dafür gegeben, dass die Klägerin entgegen der vertraglichen Regelung faktisch wie eine Arbeitnehmerin behandelt wurde.
Konsequenzen für die Praxis
- Die Entscheidung des Arbeitsgerichts Berlin steht in einem spannenden Kontrast zur sogenannten Herrenberg-Entscheidung des Bundessozialgerichts (BSG, Urteil vom 28.06.2022, Az. B 12 R 3/20 R). Dort hatte das BSG eine Musiklehrerin an einer städtischen Schule als abhängig Beschäftigte eingestuft – mit der Begründung, dass sie in die Betriebsabläufe eingegliedert sei und keine wesentlichen Freiheiten in der Gestaltung ihrer Tätigkeit habe.
- Die Feststellung eines abhängigen Beschäftigungsverhältnisses hat in der Praxis arbeitsrechtliche (Anspruch auf Urlaub/Entgeltfortzahlung etc.), sozialversicherungsrechtliche (Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen) und steuerliche (Abführung von Lohnsteuer) Konsequenzen. Kurz gesagt: Es wird teuer und in der Regel sehr ärgerlich für Arbeitgeber:innen.
- Im Fall der Berliner Musikschullehrerin gab es aber folgenden Unterschied: Musikschulen sind anders organisiert als allgemeinbildende Schulen. Es gebe keine vergleichbare Kontrolle oder Reglementierung durch den Träger. Die Klägerin habe deutlich mehr Freiheiten gehabt – sowohl in der Annahme von Unterrichtsaufträgen als auch in der Durchführung des Unterrichts. Daran knüpfte das Gericht konkret an: Die Musikschullehrerin in dem vorliegenden Fall sei insbesondere frei darin gewesen, wo ihr Unterricht stattfindet. Konkret hätte der Unterricht also auch außerhalb der Räumlichkeiten der Musikschule stattfinden können. Auch habe sie – anders als die in Arbeitsverhältnissen beschäftigten Musikschullehrkräfte – keine Verpflichtung zum Unterricht bestimmter Musikschüler gehabt, sondern habe deren Zuweisung zum Unterricht frei und ohne Erfordernis einer Begründung annehmen oder ablehnen können.
- Das Urteil bringt Klarheit für Musikschulen und andere Bildungseinrichtungen, die mit freien Mitarbeitenden arbeiten. Es zeigt, dass eine freie Mitarbeit auch bei langjähriger Tätigkeit und regelmäßiger Zusammenarbeit möglich ist – vorausgesetzt, die vertragliche und tatsächliche Ausgestaltung lässt keine persönliche Abhängigkeit erkennen.
- Gleichzeitig zeigt das Urteil, dass die sozialrechtliche Bewertung durch die Deutsche Rentenversicherung nicht automatisch zu einer arbeitsrechtlichen Einstufung als Arbeitnehmer:in führt. Die beiden Rechtsbereiche sind zwar miteinander verbunden, aber nicht deckungsgleich.
- Die Entscheidung hat über den konkreten Fall hinaus Relevanz für viele Branchen, in denen freie Mitarbeit verbreitet ist – etwa im Bildungs-, Kultur- und Gesundheitsbereich sowie in der Medien- und Kreativwirtschaft. Sie unterstreicht auch, dass die arbeitsrechtliche Einordnung nicht allein von der Dauer der Zusammenarbeit oder der Regelmäßigkeit der Tätigkeit abhängt, sondern von der tatsächlichen Ausgestaltung der Arbeitsbeziehung.
Praxistipps für Unternehmen
Das Urteil mahnt (wieder einmal) zur Sorgfalt: Bereits eine unklare oder widersprüchliche vertragliche Gestaltung kann zu erheblichen rechtlichen und finanziellen Risiken führen – etwa durch Nachzahlungen von Sozialversicherungsbeiträgen oder arbeitsrechtliche Ansprüche. Wichtig zu wissen ist, dass die Vertragsgrundlage aber nur der Ausgangspunkt ist. Das heißt, neben einer klaren vertraglichen Regelung zur Mitarbeit ist auch eine entsprechende Dokumentation des gelebten Vertragsverhältnisses dringend zu empfehlen und auf eine Einhaltung der inzwischen weitgehend geklärten Kriterien zu achten.
Tatsachenvergleich zum Urlaub nur (noch) eingeschränkt wirksam Bundesarbeitsgericht (BAG),
Urteil vom 03.06.2025 – Az. 9 AZR 104/24
Dieses Urteil hat es wirklich in sich! Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 03.06.2025 die Wirksamkeit von sogenannten Tatsachenvergleichen zur Urlaubsabgeltung erheblich eingeschränkt, was bislang „gang und gäbe“ war. Ab jetzt gilt: Ein solcher Vergleich ist nur dann wirksam, wenn er zur Klärung einer bestehenden Unsicherheit erfolgt. Die Entscheidung hat weitreichende Folgen für die arbeitsrechtliche Praxis – insbesondere bei gerichtlichen Vergleichen zur Beendigung von Arbeitsverhältnissen.
Einordnung des Urteils
Das Urteil des BAG (Az. 9 AZR 104/24) stellt eine Zäsur für die Praxis dar: Die bislang verbreitete Formulierung in gerichtlichen Vergleichen oder Aufhebungsverträgen, wonach „sämtliche Urlaubsansprüche in natura gewährt“ seien, reicht nicht mehr aus, um gesetzliche Urlaubsansprüche wirksam auszuschließen.
Das heißt, sämtliche Vorlagen müssen angepasst werden. Das Gericht betont die zwingende Geltung des gesetzlichen Mindesturlaubs und stellt klar, dass ein Verzicht nur unter engen Voraussetzungen möglich ist – nämlich zur Klärung einer tatsächlichen Unsicherheit. Eine solche liegt in den wenigsten Fällen vor.
Der Sachverhalt
Der Kläger war vom 01.01.2019 bis zum 30.04.2023 bei dem beklagten Unternehmen beschäftigt. In den letzten vier Monaten seines Arbeitsverhältnisses – vom 01.01. bis zum 30.04.2023 – war er durchgehend arbeitsunfähig erkrankt.,
Am 31.03.2023 schlossen die Parteien im Rahmen eines arbeitsgerichtlichen Vergleichs eine Vereinbarung über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum 30.04.2023. Eine Klausel des Vergleichs lautete: „Urlaubsansprüche sind in natura gewährt.“
Trotz dieser Formulierung verlangte der Kläger später die Abgeltung von sieben Tagen gesetzlichen Mindesturlaubs, die ihm für die ersten vier Monate des Jahres 2023 zustanden. Er argumentierte, dass er krankheitsbedingt keinen Urlaub habe nehmen können und die Vergleichsklausel daher unwirksam sei.
Die Entscheidung
Das BAG gab dem Kläger Recht. Es stellte fest, dass der gesetzliche Mindesturlaub nicht durch einen Tatsachenvergleich ausgeschlossen werden kann, wenn keine tatsächliche Unsicherheit über die Erfüllung der Urlaubsansprüche besteht.
Die zentralen Erwägungen des Gerichts:
- Zwingende Geltung des Mindesturlaubs: Der gesetzliche Mindesturlaub nach § 3 Bundesurlaubsgesetz (BurlG) kann während eines bestehenden Arbeitsverhältnisses nicht wirksam abbedungen werden.
- Keine Unsicherheit über Urlaubsgewährung: Der Kläger war im gesamten Zeitraum arbeitsunfähig erkrankt. Es bestand daher keine Unsicherheit darüber, ob Urlaub tatsächlich gewährt wurde.
- Unwirksamkeit des Tatsachenvergleichs: Ein Tatsachenvergleich ist nur dann wirksam, wenn er zur Klärung einer tatsächlichen Unsicherheit dient. Eine pauschale Formulierung reicht nicht aus.
- Keine Vorausregelung für die Zukunft: Für den verbleibenden Monat April konnte der Vergleich keine wirksame Regelung zur Urlaubsgewährung treffen, da der Urlaub zu diesem Zeitpunkt noch nicht konkretisiert war.
Konsequenzen für die Praxis
- Die Entscheidung hat weitreichende Bedeutung für die arbeitsrechtliche Praxis – insbesondere für gerichtliche Vergleiche zur Beendigung von Arbeitsverhältnissen. Sie betrifft nicht nur Fälle von Krankheit, sondern alle Konstellationen, in denen Urlaubsansprüche im Rahmen von Vergleichen geregelt werden.
- Die Entscheidung zwingt ab sofort zur Differenzierung: Ein pauschaler Verzicht auf Urlaub ist nicht mehr zulässig, wenn keine Unsicherheit über die Erfüllung besteht. Arbeitgeber:innen müssen künftig klar zwischen gewährtem Urlaub, noch abzugeltendem Urlaub und offenen Ansprüchen unterscheiden.
Praxistipps für Unternehmen
Für Arbeitgeber:innen und HR-Abteilungen bedeutet das Urteil, dass pauschale Formulierungen zur Urlaubsabgeltung in gerichtlichen Vergleichen und Aufhebungsverträgen künftig vermieden werden sollten.
Es ist wichtig, konkret zu dokumentieren, wann und wie Urlaub gewährt wurde – insbesondere bei längerer Krankheit. Zudem sollten Arbeitgeber:innen klar zwischen gewährtem Urlaub, noch offenem Urlaub und abzugeltendem Urlaub nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses unterscheiden.
Exkurs: Der datenschutzrechtliche Auskunftsanspruch – abdingbar oder unverzichtbar?
Im Rahmen dieses BAG-Urteils stellt sich die Frage, ob auch andere gesetzlich verankerte Ansprüche – etwa der datenschutzrechtliche Auskunftsanspruch nach Art. 15 Datenschutz-Grundverordnung (DS‑GVO) – durch vertragliche Vereinbarungen abgegolten oder abbedungen werden können. Dieser Exkurs beleuchtet die rechtliche Einordnung sowie die Positionen von Literatur, Aufsichtsbehörden und Rechtsprechung hierzu:
Rechtliche Einordnung
Der Auskunftsanspruch nach Art. 15 DS‑GVO ist ein zentrales Instrument für Betroffene, um Transparenz über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu erhalten. Er ist Ausfluss des Grundrechts auf Datenschutz gemäß Art. 8 Abs. 2 der EU-Grundrechtecharta und dient der Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung.
Die DS‑GVO selbst enthält keine ausdrückliche Regelung zur Abdingbarkeit oder zum Verzicht auf diesen Anspruch. Erwägungsgrund 4 der DS‑GVO deutet jedoch an, dass Datenschutzrechte nicht absolut sind, sondern im Rahmen der Verhältnismäßigkeit mit anderen Rechten abgewogen werden müssen.
Positionen in der Literatur
Die juristische Literatur ist sich weitgehend einig, dass ein Verzicht auf den Auskunftsanspruch für die Vergangenheit möglich ist, ein Abbedingen für die Zukunft jedoch unzulässig ist. Dies wird insbesondere mit dem Transparenzgrundsatz der DS‑GVO begründet: Der Betroffene muss jederzeit die Möglichkeit haben, die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung zu überprüfen. Ein Abbedingen im Voraus würde diesen Kontrollzweck unterlaufen und den Anspruch leerlaufen lassen. Vertreter dieser Auffassung sind u. a. Sorber, Knoepffler, Peisker sowie Garden.
Positionen der Aufsichtsbehörden
Der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) betont in seiner Leitlinie 01/2022, dass der Auskunftsanspruch nicht durch vertragliche Vereinbarungen ausgehebelt werden darf. Nur gesetzlich geregelte Ausnahmen dürfen das Auskunftsrecht beschränken.
Auch die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Saarland und der Bayerische Landesbeauftragte für Datenschutz vertreten die Auffassung, dass ein Verzicht für die Vergangenheit möglich ist, ein Abbedingen für die Zukunft jedoch nicht. Sie stützen sich dabei auf das Prinzip der Selbstbestimmung des Betroffenen.
Rechtsprechung
Die Rechtsprechung ist bislang uneinheitlich. Während das Arbeitsgericht Düsseldorf (Urteil vom 05.03.2020 – Az. 9 Ca 6557/18) eine Tendenz zum Verbot der Disposition über DS‑GVO-Rechte erkennen lässt, hat das Verwaltungsgericht Ansbach (Entscheidung vom 03.05.2024 – Az. AN K 21.00653, nicht veröffentlicht) entschieden, dass ein Verzicht im Rahmen eines Vergleichs möglich ist.
Das Oberverwaltungsgericht Saarlouis (Urteil vom 13.05.2025 – 2 A 165/24) bestätigt diese Auffassung und betont die Bedeutung der Selbstbestimmung. Gleichzeitig lässt das Gericht erkennen, dass ein Abbedingen für die Zukunft kritisch zu sehen ist.
Fazit
Der datenschutzrechtliche Auskunftsanspruch nach Art. 15 DS‑GVO ist ein wesentliches Kontrollinstrument für Betroffene. Ein Verzicht auf diesen Anspruch für die Vergangenheit ist unter Berücksichtigung der Selbstbestimmung mit guten Argumenten zulässig. Ein Abbedingen für die Zukunft hingegen ist unzulässig, da es den Transparenz- und Kontrollzweck der DS‑GVO unterläuft.
Für die arbeitsrechtliche Praxis bedeutet dies einmal mehr: Klauseln in arbeitsgerichtlichen Vergleichen müssen sorgfältig formuliert werden, um nicht gegen die DS‑GVO zu verstoßen. Ein pauschaler Ausschluss des Auskunftsanspruchs ist nicht zulässig.
Kein Präventionsverfahren in der Probezeit – BAG konkretisiert Kündigungsschutz für schwerbehinderte Arbeitnehmer:innen
BAG, Urteil vom 03.04.2025 – 2 AZR 178/24
Das Bundesarbeitsgericht hat klargestellt, dass schwerbehinderte Arbeitnehmer:innen während der Wartezeit des Kündigungsschutzgesetzes keinen Anspruch auf ein Präventionsverfahren nach § 167 Abs. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) IX haben. Die Entscheidung konkretisiert die Reichweite des Kündigungsschutzes in der Probezeit und grenzt die Schutzmechanismen für schwerbehinderte Beschäftigte deutlich ein.
Einordnung des Urteils
Mit Urteil vom 03.04.2025 (Az. 2 AZR 178/24) hat das BAG entschieden, dass das Präventionsverfahren nach § 167 Abs. 1 SGB IX nicht bereits in der Probezeit eines Arbeitsverhältnisses durchgeführt werden muss. Die Entscheidung betrifft schwerbehinderte Arbeitnehmer:innen und deren besonderen Kündigungsschutz – und stellt klar, dass dieser Schutz erst nach Ablauf der sechsmonatigen Wartezeit des Kündigungsschutzgesetzes greift.
Das Urteil ist praxisrelevant für alle Arbeitgeber:innen, die schwerbehinderte Personen beschäftigen, und für die arbeitsrechtliche Bewertung von Kündigungen in der Probezeit.
Der Sachverhalt
Der Kläger, ein schwerbehinderter Arbeitnehmer mit einem Grad der Behinderung (GdB) von 80, war als Leiter der Hausund Betriebstechnik beschäftigt. Der Arbeitgeber hielt ihn fachlich für ungeeignet und kündigte das Arbeitsverhältnis nach drei Monaten – also noch innerhalb der sechsmonatigen Wartezeit des Kündigungsschutzgesetzes. Der Arbeitnehmer erhob Kündigungsschutzklage. Er argumentierte, dass die Kündigung unwirksam sei, weil kein Präventionsverfahren nach § 167 Abs. 1 SGB IX durchgeführt worden sei und ihm kein behinderungsgerechter Arbeitsplatz angeboten wurde.
Die Entscheidung
Das BAG wies die Klage ab. Es stellte fest, dass die Kündigung nicht wegen der Schwerbehinderung erfolgt sei, sondern wegen mangelnder fachlicher Eignung. Es gebe keine Anhaltspunkte für eine Diskriminierung.
Zudem führte das Gericht aus:
- Kein Anspruch auf Präventionsverfahren in der Wartezeit: Das Präventionsverfahren nach § 167 Abs. 1 SGB IX setzt voraus, dass das Kündigungsschutzgesetz anwendbar ist. Dies ist erst nach sechs Monaten der Fall.
- Keine formelle Wirksamkeitsvoraussetzung: Die Nichtdurchführung eines Präventionsverfahrens führt nicht automatisch zur Unwirksamkeit der Kündigung. Es handelt sich nicht um eine zwingende Voraussetzung für die Wirksamkeit.
- Keine Pflicht zur behinderungsgerechten Arbeitsplatzgestaltung in der Probezeit: Auch insoweit besteht keine Verpflichtung, wenn die Kündigung nicht auf die Schwerbehinderung gestützt wird.
Das BAG betonte, dass der besondere Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen nicht schrankenlos gilt, sondern an die allgemeinen Voraussetzungen des Kündigungsschutzgesetzes gekoppelt ist.
Konsequenzen für die Praxis
- Die Entscheidung hat über den konkreten Fall hinaus Bedeutung für alle Arbeitsverhältnisse mit schwerbehinderten Beschäftigten – insbesondere in der Anfangsphase. Sie stellt klar, dass der besondere Schutz nach dem SGB IX nicht automatisch greift, sondern an die allgemeine Wartezeit des Kündigungsschutzgesetzes gekoppelt ist.
- Für Arbeitgeber:innen bedeutet das mehr Klarheit bei der Gestaltung von Probezeitverhältnissen mit schwerbehinderten Mitarbeitenden. Für Arbeitnehmer:innen relativiert das Urteil die Erwartung, bereits ab dem ersten Tag des Arbeitsverhältnisses umfassend geschützt zu sein.
- Die Entscheidung ist auch ein Beitrag zur Systematik des Kündigungsschutzes: Sie zeigt, dass arbeitsrechtliche Schutzmechanismen abgestuft greifen und nicht isoliert betrachtet werden können.
Praxistipps
Arbeitgeber:innen sollten bei der Beschäftigung schwerbehinderter Personen in der Probezeit sorgfältig dokumentieren, dass etwaige Kündigungen nicht auf die Behinderung gestützt sind, sondern auf objektive Gründe wie mangelnde Eignung oder fehlende Zusammenarbeit.
Die Durchführung eines Präventionsverfahrens ist in dieser Phase nicht verpflichtend, kann aber im Einzelfall zur Konfliktvermeidung beitragen. Arbeitnehmer:innen mit Schwerbehinderung sollten sich bewusst sein, dass der volle Kündigungsschutz erst nach sechs Monaten greift. Dennoch können sie bei Anzeichen von Diskriminierung oder Benachteiligung rechtlich gegen eine Kündigung vorgehen – insbesondere, wenn die Behinderung offensichtlich eine Rolle spielt.
Rechtsabteilungen und HR sollten interne Prozesse zur Dokumentation von Probezeitkündigungen überprüfen und sicherstellen, dass die Gründe nachvollziehbar und nicht diskriminierend sind.
Dr. Michaela Felisiak, Councel bei Eversheds Sutherland/ Fachanwältin für Arbeitsrecht