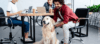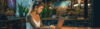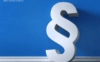Im Blick Arbeitsrecht
Arbeitsrecht 2025: Hunde im Büro, Lohn bei Tattoo-Komplikationen & Probezeitkündigungen – praktische Tipps für Arbeitgeber auf einen Blick.
Vierbeiner im Büro – Duldung ist keine Genehmigung
Landesarbeitsgericht Düsseldorf (LAG) vom 08.04.2025 – 8 GLa 5/25
In immer mehr Branchen gehören Hunde im Büro zum Alltag. Viele Arbeitgebende sehen darin eine Möglichkeit, das Betriebsklima zu verbessern und Mitarbeitende an das Unternehmen zu binden. Rechtlich gesehen gibt es jedoch keinen generellen Anspruch auf die Mitnahme des eigenen Vierbeiners an den Arbeitsplatz. Die Entscheidung darüber trifft der oder die Arbeitgeber*in im Rahmen des Direktionsrechts nach § 106 Gewerbeordnung. Kommt es zum Streit, müssen Gerichte abwägen, ob eine bloße Duldung über Jahre hinweg einen Anspruch begründen kann und welche Interessen überwiegen. Das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf hatte sich im Frühjahr 2025 mit einem solchen Fall zu beschäftigen – und ließ die Herzen der Hundebesitzer höher schlagen, aber am Ende überwog die arbeitsrechtliche Ordnung.
Einordnung des Urteils
Rechtlicher Ausgangspunkt ist, dass das Mitbringen von Haustieren nicht zu den Hauptleistungspflichten aus dem Arbeitsvertrag gehört und daher dem Weisungsrecht des Arbeitgebers unterliegt. Das LAG Düsseldorf betonte in seiner Entscheidung vom 08.04.2025 (Az. 8 GLa 5/25), dass ein ausdrücklich vereinbartes Tierverbot wirksam bleibt, selbst wenn es über Jahre hinweg nicht durchgesetzt wurde. Eine langjährige stillschweigende Duldung begründet weder eine konkludente Vertragsänderung noch eine betriebliche Übung, weil es dazu mehrerer Fälle bedarf und ein erkennbarer Rechtsbindungswille des Arbeitgebers vorliegen muss. Die Zulassung von Haustieren muss stets die Schutzinteressen anderer Beschäftigter und Kund*innen berücksichtigen. Deshalb kann der Arbeitgeber die Erlaubnis widerrufen, sobald Beschwerden über Allergien, Ängste oder Störungen auftreten. Der Betriebsrat besitzt zwar ein Mitbestimmungsrecht bei Fragen der Ordnung im Betrieb (§ 87 Abs. 1 Nr. 1 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)), aber er kann ein Tierverbot nicht gegen den Willen des Arbeitgebers durchsetzen.
Der Sachverhalt
Die Klägerin arbeitet seit 2013 als Spielhallenaufsicht in Vollzeit. Ihr Arbeitsvertrag enthält die klare Regelung, dass „Haustiere in der Spielhalle verboten“ sind. Nachdem sie 2019 eine Tierschutzhündin namens Lori aufgenommen hatte, brachte sie diese trotz des Verbots regelmäßig mit zur Arbeit. Über Jahre hinweg duldeten wechselnde Vorgesetzte die Mitnahme. Mit Schreiben vom 07.03.2025 wies der Geschäftsführer unter Hinweis auf die Stellenbeschreibung darauf hin, dass die Hündin künftig nicht mehr mitgebracht werden dürfe. Hintergrund waren Beschwerden von Kolleg*innen und Kund*innen, etwa wegen Allergien oder Ängsten. Die Arbeitnehmerin beantragte im einstweiligen Rechtsschutz, die Mitnahme ihres Hundes bis zum Abschluss eines Hauptsacheverfahrens zu erlauben. Sie argumentierte, durch die jahrelange Duldung sei eine „betriebliche Übung“ entstanden und eine plötzliche Trennung sei ihr nicht zuzumuten. Der Arbeitgeber erwiderte, die arbeitsvertragliche Klausel sei eindeutig; außerdem könnten nicht die Vorgesetzten vor Ort darüber entscheiden, ob das Verbot aufgehoben werde.
Die Entscheidung
Das LAG Düsseldorf wies den Antrag zurück. Zwar erkannte das Gericht an, dass die Arbeitnehmerin eine enge Bindung zu ihrem Hund hat, doch das emotionale Interesse begründet keinen Rechtsanspruch. Entscheidend war die arbeitsvertragliche Verbotsklausel, die weiterhin Wirkung entfaltete. Eine bloße Nichtdurchsetzung durch Vorgesetzte hebt ein Verbot nicht auf – der Arbeitgeber bleibt berechtigt, es jederzeit durchzusetzen. Für eine betriebliche Übung fehlten die typischen Voraussetzungen: Es müssten mehrere Beschäftigte über einen längeren Zeitraum Haustiere mitbringen, damit ein aus der Sicht des Arbeitgebers bindendes Vertrauen entstehen kann. Das Gericht stellte klar, dass der Arbeitgeber aufgrund seines Hausrechts das Verbot aufrechterhalten darf, insbesondere wenn andere Gäste oder Mitarbeitende sich bedroht fühlen, Allergien haben oder es gar zu Störungen im Betriebsablauf kommt. Zudem sah die Kammer die Zumutbarkeit der von der Arbeitnehmerin geschilderten Alternativen kritisch; sie müsse sich um eine Fremdbetreuung kümmern, wenn sie die Hündin während der Arbeitszeit nicht selbst betreuen kann. Um dem sozialen Moment Rechnung zu tragen und das Arbeitsverhältnis zu erhalten, schlugen die Richter einen Vergleich vor: Die Arbeitnehmerin durfte den Hund noch bis zum 31.05.2025 mitbringen; danach bedurfte es einer ausdrücklichen Genehmigung.
Konsequenzen für die Praxis
- Bemerkenswert an der Entscheidung ist, dass das Gericht auf ein früheres Urteil aus 2014 Bezug nahm, bei dem die Mitnahme einer dreibeinigen Hündin ebenfalls untersagt wurde. Es zeigt, dass die Rechtsprechung an der strengen Linie festhält.
- Aus Arbeitgebersicht bedeutet das Urteil, dass eine vertragliche Regelung stets Vorrang hat und eine stillschweigende Duldung nicht leichtfertig als Genehmigung umgedeutet werden kann. Wer Haustiere zulässt, sollte sich bewusst sein, dass daraus nicht automatisch ein vorbehaltloses Recht für andere Beschäftigte entsteht.
- Eine Genehmigung kann jederzeit widerrufen werden und steht unter einem Vorbehalt – etwa wenn das Tier nicht stubenrein ist, Kollegen sich bedroht fühlen oder Allergien vorliegen. Arbeitsrechtlich bleibt die Möglichkeit, Assistenzhunde – etwa Blindenführhunde – ausnahmsweise zuzulassen; hier bestehen ohnehin gesetzliche Ansprüche.
- Spannend bleibt die Frage nach der Mitbestimmung: Der Betriebsrat kann bei kollektiven Regelungen zur Ordnung im Betrieb mitreden. Ob er aber ein generelles Vetorecht gegen ein Tierverbot hat, ist bisher offen. Die besseren Argumente sprechen dafür, dass die Mitnahme von Tieren in erster Linie das Direktionsrecht betrifft, während der Betriebsrat nur bei der Ausgestaltung von Regeln zur Mitnahme oder bei der Auswahl eines bestimmten Bereichs mitbestimmen kann.
Praxistipps für Unternehmen
Wer die Mitnahme von Tieren erlauben oder verbieten möchte, sollte dies ausdrücklich regeln – am besten im Arbeitsvertrag, in einer Haustier-Richtlinie oder in einer Betriebsvereinbarung. Eine klare Kommunikation und Dokumentation schützt davor, dass eine jahrelange Duldung als „rechtswirksame Genehmigung“ interpretiert wird. Unternehmen müssen zudem die Interessen von anderen Mitarbeitenden und Kund*innen berücksichtigen und dürfen Erlaubnisse widerrufen, wenn Störungen auftreten.
Checkliste: Haustiere am Arbeitsplatz
Diese kurze Checkliste fasst die wesentlichen Punkte zusammen, die Arbeitgeber*innen berücksichtigen sollten, wenn Mitarbeitende ihre Tiere mitbringen möchten.
- Klare Regelungen treffen:
- Arbeitsvertrag oder Betriebsvereinbarung prüfen: Ist die Mitnahme von Haustieren ausdrücklich erlaubt oder verboten? Wenn nicht, sollte eine Regelung eingefügt werden.
- Erlaubnisvorbehalt formulieren: Halten Sie schriftlich fest, unter welchen Bedingungen ein Tier mitgebracht werden darf (z. B. Haftpflichtversicherung, Maulkorb, Impfstatus, Stubenreinheit).
- Tierarten definieren: Legen Sie fest, welche Tierarten generell zugelassen werden und welche ausgeschlossen sind (z. B. Listenhunde).
- Widerrufsvorbehalt einbauen
- Erlaubnis nur bis auf Widerruf erteilen: Machen Sie deutlich, dass die Genehmigung für Haustiere widerrufen werden kann, falls Störungen auftreten (z. B. Allergien, Ängste, aggressives Verhalten).
- Interessenabwägung dokumentieren: Notieren Sie, warum ein Widerruf erforderlich ist, und halten Sie die Beschwerden oder Sicherheitsbedenken fest.
- Gesundheits- und Sicherheitsaspekte prüfen
- Hygienische Anforderungen: Überprüfen Sie, ob Lebensmittelhygiene oder Maschinenarbeit das Mitbringen von Tieren ausschließen.
- Arbeitsplatzspezifische Risiken: Berücksichtigen Sie Gefährdungsbeurteilungen. In Bereichen mit erhöhtem Unfall oder Infektionsrisiko sollte ein Verbot gelten.
- Betriebliche Übung vermeiden
- Nicht tatenlos zusehen: Reagieren Sie auf Verstöße gegen ein Tierverbot, um die Entstehung einer betrieblichen Übung zu verhindern.
- Abmahnen bei Wiederholung: Sprechen Sie bei hartnäckigen Verstößen eine Abmahnung aus und machen Sie deutlich, dass das Verbot weiterhin gilt.
- Mitbestimmung berücksichtigen
- Betriebsrat einbinden: Bei kollektiv geltenden Regelungen zur Ordnung im Betrieb hat der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht. Beziehen Sie ihn in die Ausgestaltung ein.
- Transparente Kommunikation: Informieren Sie alle Beschäftigten über die Haustierregelung und deren Hintergründe, um Missverständnisse zu vermeiden.
Kein Lohn bei Krankheit durch ein entzündetes Tattoo
LAG Schleswig-Holstein vom 22.05.2025 – 5 Sa 284 a/24
Tätowierte Haut gilt heute als Ausdruck persönlicher Freiheit. Über ein Drittel der Deutschen trägt ein Motiv unter der Haut, besonders die jüngeren Generationen finden Gefallen an dieser Art der Körperkunst. Was viele nicht wissen: Wer sich für diese Art eines freiwilligen Eingriffs entscheidet und anschließend krankheitsbedingt ausfällt, riskiert seinen Anspruch auf Lohnfortzahlung. Der Fall einer Pflegehilfskraft aus Schleswig‑Holstein zeigt, wo die Grenzen liegen und warum die Rechtsprechung Tattoos als besonders riskanten Eingriff einstuft.
Einordnung des Urteils
Nach § 3 Abs. 1 Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) zahlt der Arbeitgeber den Lohn im Krankheitsfall nur, wenn die Arbeitsunfähigkeit ohne eigenes Verschulden eintritt. Der Gesetzgeber will damit eine Balance schaffen: Er entlastet Arbeitnehmer*innen bei unverschuldeten Erkrankungen, verlangt ihnen aber ab, die eigene Gesundheit zu schützen und vermeidbare Erkrankungen zu verhindern. Ein „Verschulden gegen sich selbst“ liegt vor, wenn man das eigene Gesundheitsinteresse grob missachtet, zum Beispiel indem man sich bewusst in Gefahr begibt.
Der Sachverhalt
Die Klägerin war seit Jahren als Pflegehilfskraft beschäftigt. Im Frühjahr 2025 ließ sie sich privat ein Tattoo auf dem Unterarm stechen. Wenige Tage später entzündete sich die tätowierte Stelle. Sie legte eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vor und forderte von ihrem Arbeitgeber die Entgeltfortzahlung für die Ausfallzeit. Das Unternehmen lehnte ab – sie habe die Erkrankung selbst verschuldet. Die Arbeitnehmerin argumentierte, Tätowierungen seien Teil der privaten Lebensführung und Komplikationen träten nur in ein bis fünf Prozent der Fälle auf; man könne sie daher als seltenes Risiko betrachten. Außerdem sei die Entzündung zeitlich vom eigentlichen Tattoovorgang getrennt und damit als eigenständige Krankheit zu werten.
Die Entscheidung
Das Landesarbeitsgericht folgte dieser Argumentation nicht. Es stellte zunächst klar, dass ein entzündetes Tattoo keine eigenständige Erkrankung ist, sondern eine typische Folge der bewussten Hautverletzung beim Tätowieren. Die Klägerin habe nach eigenem Vortrag gewusst, dass in bis zu fünf Prozent der Fälle Hautentzündungen auftreten. In der medizinischen Bewertung gelten Nebenwirkungen bereits ab ein Prozent als „häufig“. Wer sich tätowieren lasse, wisse also, dass Komplikationen keineswegs fernliegen.
Das Gericht qualifizierte das Verhalten der Pflegehilfskraft daher als groben Verstoß gegen das eigene Gesundheitsinteresse und als „Verschulden gegen sich selbst“. Entscheidend sei nicht, ob der genaue Verlauf der Komplikation vorhersehbar war, sondern dass die Klägerin den Eingriff wissentlich in Kauf nahm und damit auch den mit ihm verbundenen Risiken zustimmte. Die Kammer verwies dazu auf die Einordnung in der Arzneimittel Terminologie: Nebenwirkungen gelten bereits ab ein Prozent Auftretenshäufigkeit als häufig, sodass eine Komplikationsrate von bis zu fünf Prozent keinesfalls ein geringes Risiko darstellt.
Hinzu kam, dass die Klägerin als Pflegehilfskraft körperlich arbeitete und engen Kontakt zu Patientinnen und Patienten hatte. Das Gericht ging deshalb sogar von einer höheren Infektionsgefahr aus als bei reinen Bürotätigkeiten. Die Revision zum Bundesarbeitsgericht ließ das LAG nicht zu.
Konsequenzen für die Praxis
- Das LAG stellte auch einen rechtspolitischen Zusammenhang her. Es verwies auf § 52 Abs. 2 Sozialgesetzbuch (SGB) V, nach dem Krankenkassen bei medizinisch nicht indizierten ästhetischen Eingriffen – wie Tattoos oder Piercings – die Leistungen einschränken oder das Krankengeld versagen dürfen. Vor diesem Hintergrund erscheine es sachgerecht, die Risiken solcher Lifestyle Entscheidungen nicht auf die Arbeitgeber oder Versichertengemeinschaft abzuwälzen.
- Die Entscheidung fügt sich in die Rechtsprechung zu Selbstgefährdung und bedingtem Vorsatz ein. Anders als bei sportlichen Unfällen, bei denen die Unfallgefahr oft unbeherrschbar und nicht zielgerichtet herbeigeführt wird, handelt es sich bei Tätowierungen um einen willentlich herbeigeführten Eingriff in den Körper. Der Vorsatz bei der Tätowierung erstreckt sich nach Ansicht des Gerichts als „bedingter Vorsatz“ auch auf mögliche Folgeschäden: Wer sich tätowieren lässt, akzeptiert das Risiko, dass sich die Wunde entzündet und eine längere Arbeitsunfähigkeit nach sich zieht.
Praxistipps für Unternehmen
Die Entscheidung warnt Arbeitnehmende: Wer sich für eine Tätowierung entscheidet, trägt nicht nur Verantwortung für das Motiv, sondern auch für die möglichen gesundheitlichen Folgen. Kommt es zu einer Komplikation, die eine Arbeitsunfähigkeit verursacht, kann der Lohnanspruch entfallen. Bei Pflege und anderen körpernahen Berufen ist das Risiko einer Infektion besonders hoch. Es lohnt sich daher, solche Eingriffe in den Urlaub zu legen, auf eine sorgfältige Hygiene zu achten und ggf. eine Ausfallzeit finanziell einzuplanen.
Arbeitgeber*innen sollten bei Krankmeldungen nach ästhetischen Eingriffen genauer hinsehen. Sie sind berechtigt, die Entgeltfortzahlung zu verweigern, wenn eine arbeitsunfähige Erkrankung auf einem bewusst eingegangenen Risiko beruht. Dabei ist sorgfältig zu prüfen, ob der Eingriff medizinisch notwendig war, wie hoch das Komplikationsrisiko ist und ob die Nachsorgevorschriften eingehalten wurden. Ebenso sollten Arbeitgeber*innen transparent darüber informieren, dass freiwillige Eingriffe mit Komplikationsrisiken die Lohnfortzahlung gefährden können.
Unwirksamkeit einer Probezeitkündigung wegen widersprüchlichen Verhaltens
LAG Düsseldorf vom 14.01.2025 – 3 SLa 317/24
Probezeitkündigungen gelten häufig als „sichere Bank“: Innerhalb der ersten sechs Monate eines Arbeitsverhältnisses findet das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) keine Anwendung, und viele Arbeitgeber gehen davon aus, dass sie jederzeit ohne besondere Begründung kündigen können. Doch selbst in diesem Zeitraum sind die allgemeinen Grundsätze von Treu und Glauben zu beachten. Das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf hat dies mit Urteil vom 14.01.2025 (Az. 3 SLa 317/24) eindrucksvoll bestätigt. Wenn ein Vorgesetzter kurz vor Ablauf der Probezeit eine verbindlich wirkende Zusage zur Weiterbeschäftigung macht und wenige Tage später ohne nachvollziehbaren Grund kündigt, kann dies als widersprüchliches Verhalten gewertet werden. Die Kündigung ist dann treuwidrig und unwirksam.
Einordnung des Urteils
Der Fall spielt in einer Grauzone zwischen kollektivem und individuellem Kündigungsschutz. Während der sechsmonatigen Wartezeit des § 1 Abs. 1 KSchG genießt der Arbeitnehmer keinen allgemeinen Kündigungsschutz; der Arbeitgeber kann das Arbeitsverhältnis grundsätzlich ohne sozialen Rechtfertigungsgrund beenden.
Gleichwohl bleibt das zivilrechtliche Institut des „venire contra factum proprium“ anwendbar: Nach § 242 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) ist eine Kündigung treuwidrig, wenn der Arbeitgeber durch eigenes Verhalten einen schutzwürdigen Vertrauenstatbestand begründet und diesen ohne sachlichen Grund zerstört. Auch während der Probezeit sind Arbeitgeber an eine „innere Stimmigkeit“ gebunden und dürfen nicht völlig widersprüchlich handeln. Die Entscheidung reiht sich in eine Linie von Urteilen ein, in denen Gerichte Zusicherungen während der Probezeit als verbindlich ansahen, wenn sie ernsthaft und durch eine entscheidungsbefugte Person abgegeben wurden. Sie zeigt, dass Arbeitnehmer sich auf solche Zusagen berufen können, sofern sie hinreichend konkret sind.
Der Sachverhalt
Der Arbeitnehmer war seit dem 15.06.2023 als Wirtschaftsjurist in der Abteilung Recht/Compliance in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis beschäftigt. Sein Anstellungsvertrag sah u. a. eine sechsmonatige Probezeit vor. Abteilungsleiter und Dienstvorgesetzter des Arbeitnehmers war Herr U. Diesem war Prokura erteilt. Er war als Führungskraft für Personalfragen zuständig und hatte den Anstellungsvertrag des Mitarbeiters unterzeichnet.
Am 17.11.2023 teilte Herr U. dem Mitarbeiter mit, er habe über seinen Workflow die Anfrage von der Personalabteilung erhalten, ob der Arbeitnehmer mit Blick auf die Probezeit übernommen werden solle. Herr U. sagte dann: „Das tun wir natürlich.“ Daraufhin bedankte sich der Mitarbeiter bei Herrn U. und erklärte, dass er sich darüber freue.
Da der Arbeitnehmer aus Arbeitgebersicht keine ausreichenden Leistungen erbrachte, teilte Herr U. ihm am 08.12.2023 mit, dass sein Arbeitsverhältnis in der Probezeit beendet werden solle.
Mit Schreiben vom selben Tag wurde die ordentliche Kündigung erklärt.
Das Kündigungsschreiben war von Herrn U. unterschrieben. Gegen die Kündigung setzte sich der Arbeitnehmer gerichtlich zur Wehr.
Die Entscheidung
Das LAG gab dem Arbeitnehmer Recht. Die streitgegenständliche Probezeitkündigung sei treuwidrig und damit unwirksam. Zur Begründung führte das Gericht insbesondere aus:
Die Vorschrift des § 242 BGB sei auf Kündigungen neben § 1 Kündigungsschutzgesetz (KSchG) nur in beschränktem Umfang anwendbar. Eine Kündigung verstoße nur dann gegen § 242 BGB, wenn sie Treu und Glauben aus Gründen verletze, die von § 1 KSchG nicht erfasst seien, wie z. B. bei widersprüchlichem Verhalten des Arbeitgebers.
Eine unzulässige Rechtsausübung liege vor, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer durch sein Verhalten Anlass gegeben habe, zu glauben, das Arbeitsverhältnis werde längere Zeit fortbestehen, und dann plötzlich kündige.
Etwas anderes gelte nur dann, wenn der Arbeitgeber sich auf einen besonderen, nachträglich entstandenen sachlichen Grund berufen könne. Für solche rechtfertigende Umstände sei der Arbeitgeber im Rahmen seiner gestuften Darlegungslast darlegungspflichtig.
Vorliegend folgte aus der mündlichen Mitteilung von Herrn U. gegenüber dem Arbeitnehmer, „natürlich“ werde er übernommen, dass er die Probezeit bestanden habe. Diese Äußerung habe kein „normaler“ Vorgesetzter ohne Personalentscheidungskompetenzen getätigt, sondern Herr U. Er sei als Dienstvorgesetzter des Arbeitnehmers zugleich der mit Prokura versehene Abteilungsdirektor der Abteilung Recht/Compliance und damit unstreitig die Führungskraft für Personalfragen in dieser Abteilung, der zudem sowohl den Anstellungsvertrag des Mitarbeiters als auch die spätere, streitgegenständliche Kündigung unterschrieben hatte.
Arbeitgeberseits sei nicht vorgetragen worden, dass zwischen dieser Erklärung und der Kündigung Vorkommnisse vorgefallen seien, die einen Meinungsumschwung sachlich rechtfertigen könnten.
Konsequenzen für die Praxis
- Besonders in der Probezeit neigen Arbeitgeber*innen zu mündlichen Zusagen, ohne sich der rechtlichen Tragweite bewusst zu sein. Hierbei ist jedoch besondere Vorsicht geboten, vor allem bei Äußerungen von Vorgesetzten mit Personalentscheidungskompetenzen. Wer als Entscheidungsbefugter mündliche Zusagen ausspricht – etwa die „natürliche“ Übernahme nach bestandener Probezeit –, schafft schutzwürdiges Vertrauen. Eine spätere gegenteilige Entscheidung ohne nachvollziehbaren Grund kann treuwidrig sein.
- Behauptet der Arbeitnehmer widersprüchliches Verhalten, muss der Arbeitgeber im Rahmen seiner Darlegungslast konkrete Tatsachen vortragen, die den Meinungswechsel erklären. Bloße Behauptungen unzureichender Leistung ohne Beispiele reichen nicht aus.
- Wichtig: Die Entscheidung betrifft nur Fälle, in denen der Arbeitgeber sich widersprüchlich verhält. Im Übrigen bleibt eine Probezeitkündigung wirksam, sofern keine Diskriminierung oder eine andere Treuwidrigkeit vorliegen.
Praxistipps
Arbeitgeber/Arbeitgeberinnen sollten Folgendes beachten:
- Keine Unterschätzung von Probezeitkündigungen: Selbst wenn der persönliche Geltungsbereich des KSchG wegen Nichterfüllung der sechsmonatigen Wartezeit (vgl. § 1 Abs. 1 KSchG) nicht eröffnet ist, ist die Kündigung am Maßstab des § 242 BGB zu messen – wenn auch nur in eingeschränktem Umfang.
- Keine falschen Erwartungen bei dem Arbeitnehmer/der Arbeitnehmerin wecken.
- Verantwortungsbewusster Umgang mit vertrauensbildenden Äußerungen, wie z. B. Übernahmezusagen während der Probezeit, gegenüber dem Arbeitnehmer/der Arbeitnehmerin.
- Besondere Sorgfalt bei Äußerungen von Führungskräften mit Entscheidungsbefugnis.
- Schulung von Führungskräften mit Entscheidungsbefugnis: Insbesondere in der Probezeit sollten Führungskräfte mit Entscheidungsbefugnis keine unabgestimmten Aussagen bezüglich des Bestehens der Probezeit treffen.
Dr. Michaela Felisiak, Councel bei Eversheds Sutherland/ Fachanwältin für Arbeitsrecht